
Unsere Diskussionsforen
Wir freuen uns auf Ihren Beitrag
Auf unserer Website „theologie-naturwissenschaften.de“ werden pro Jahr vier bis sechs Leitartikel von prominenten Autoren aus dem Themenfeld Dialog zwischen Theologie und Naturwissenschaften veröffentlicht. Wir laden Sie ein, zu diesen Leitartikeln ins Gespräch zu kommen.
Im Folgenden finden Sie eine Übersicht mit je einer prägnanten These pro Leitartikel. Der weiterführende Link führt Sie dann direkt zum Leitartikel. Dort können Sie gleich unter dem Artikel einen Diskussionsbeitrag schreiben und ins Gespräch kommen.
Weitere Diskussionsmöglichkeiten
Consequences of Quantum Theory
What follows for theology?
Aktueller Kommentar in der Diskussion zum Artikel:
Konsequenzen der Quantentheorie
Was folgt für die Theologie?
Aktueller Kommentar in der Diskussion zum Artikel:
Reiner Groth
am 10.11.2012eine naturgesetzliche Verlässlichkeit entsteht, aber in den Mikrowelten die Phänomene statistisch zu beschreiben sind. In Wirklichkeit herrscht nirgendwo eine andere Logik als die von Freiheit und Ordnung; auch die Elementarakteure sind determiniert durch ihre eigene Natur oder Beschaffenheit, zugleich aber mit Spontaneität „begabt“ - wie alles Geschaffene.
Gibt es einen freien Willen?
Oder sollte man besser von der "Freiheit der Person" sprechen? Was meinen Sie?
Aktueller Kommentar in der Diskussion zum Artikel:
Ingo-Wolf Kittel
am 30.06.2013Da die Gedanken bekanntlich frei sind, können Si und denken Sie selbstverständlich, was Sie wollen; und weil wir Meinungsfreiheit haben, steht Ihnen genauso gut frei, die frei äußern.
Nur ob und ggf. welche Gründe Sie haben so zu denken wie und was Sie denken, haben Sie damit nicht auch schon gesagt.
Allerdings müsste das, was Sie denken, als erstes auf Sie selbst zutreffen. Dann bleibt mir nur zu schließen, dass Sie nicht anders können als Sie sind - um Singers schlechtes Deutsch weiter zu benutzen.
Dann sind auch im Weiteren von Ihnen sicher auch keine Argumente mehr zu erwarten...
Mit besten Grüßen in ihre Galerie! IWK
Einstein als Anwalt religiöser Toleranz?
Die neuen Erkenntnisse unseres Gastautors Markus Mühling zu Einsteins Religion
Aktueller Kommentar in der Diskussion zum Artikel:
Andreas Losch
am 03.11.2012Willem B. Drees fragt: Ist das Universum erklärbar oder ein Mysterium?
Ihre Meinung ist gefragt!
Aktueller Kommentar in der Diskussion zum Artikel:
Helmut Hansen
am 18.03.2014Tatsächlich aber lässt sich dieser Bereich ebenso mit Mitteln der Wissenschaft aufklären wie einst das Atom. Der Schlüssel hierzu ist eine sehr grundlegende und einfache Erkenntnis: Ein Universum, dessen letzter und eigentlicher Grund transzendenter Natur ist, muss zwangsläufig sehr sehr speziellen Bedingungen genügen. Wenn es uns gelänge, diese Bedingungen zu spezifizieren, dann könnten wir u.U. erfahren, ob unser (!) Universum diesen Bedingungen genügt. Wäre dies der Fall, dann hätten wir Grund zu der Annahme, dass unser Universum ein Universum mit transzendentem Grund ist.
Bis heute ist jedoch niemand dieser Erkenntnis systematisch nachgegangen.
Zum Leitartikel von Ulrich Pontes: Durchgeknallte Teilchenphysik?
Ihre Meinung zum Thema des Leitartikels
Aktueller Kommentar in der Diskussion zum Artikel:
Andreas Losch
am 29.09.2011Zum Leitartikel "Zeit zum Umdenken? Unsere gegenwärtige Verantwortung für die Umwelt" von Günter Altner
Ist es Zeit, zu handeln? Diskutieren Sie mit!
Aktueller Kommentar in der Diskussion zum Artikel:
Jochen Luhmann
am 10.06.2011beim Atomausstieg im zweiten Anlauf
Ich stimme Günter Altner in der folgenden Pointierung zu: Das entscheidende Handeln ist die Präparierung der Wahrnehmung; oder der Verzicht darauf. Jedenfalls die Wahrnehmung. Das nimmt Druck aus der Fokussierung auf das Handeln i.e.S.
Worte sind mächtig. Für sie gilt das Gleichnis von David und Goliath. Große Worte helfen wenig. Kleine Worte können viel austragen. Zudem gilt: Worte können beschreibend oder fordernd verwendet werden. Auch da gilt das Gesetz von David und Goliath: Forderung ist eher machtlos. Beschreibung kann sehr machtvoll sein. Wenn sie präzise und wahrhaftig ist. Maßstab ist, was „ist“, die „Realität“. Nicht im Sinne des Positivismus. Vielmehr in dem Sinne, wie es von Michael Voslensky und Adam Michnik erneut ans Licht gebracht worden ist: Sie haben den „real existierenden Sozialismus“ anscheinend lediglich beschrieben und haben damit, mit dieser neugeschaffenen Wahrnehmung entscheidend dazu beigetragen, die Transformation von Mittel- und Osteuropa auszulösen.
Das ist ein ermutigendes Modell. Auch für uns, in unserer Gesellschaft, an deren Entwicklungstendenzen wir schier zu verzweifeln geneigt sein können, muss es eine vergleichbare „Realität“ geben. Eine, die wir bislang nicht sehen; die aber, wenn es uns gelingt, sie überzeugend in dem Sinne zu beschreiben, dass es uns wie Schuppen von den Augen fällt, vermutlich eine vergleichbare Verwandlungskraft zu entfalten vermag. Im Detail ist zu vermuten: Sie wird beim Atomausstieg ihr Spiel mit uns treiben, sicherlich auf der Seite der (potentiellen) Opfer, bei der Bewertung des ‚Risikos’ also.
Der Atomausstieg gemäß der 13. Novelle des Atomgesetzes (AtG) ist quantitativ identisch mit dem Atomkonsens von Rot-Grün, wie er am 14. Juni 2000 paraphiert worden war. Der hat die KKW-Betreiber der vollen Nutzbarkeit ihres Anlagenparks versichert: Jedes KKW sollte eine Menge an Elektrizität produzieren können, wie in „32 Betriebsjahren“ abzufahren ist. Das bleibt unangetastet.
Der Beschluss der Koalitionsspitzen in der Nacht vom 29. auf den 30. Mai sah dieses sakrosankten Rechtevolumens wegen keinen Kaskaden-artigen Ausstieg vor sondern einen Wasserfall-artigen, zu Beginn des nächsten Jahrzehnts, und deshalb lediglich eine Spätest-Abschaltung für sechs Reaktoren auf Ende 2021 und für drei Reaktoren auf Ende 2022. Das war vom Rechte-Budget her kalkuliert, da war Platz gelassen für 12 Betriebsjahre. In der Verhandlung am 3. Juni 2011 bestanden die Ministerpräsidenten der Länder auf einer Korrektur, sie wollten einen schrittweisen Ausstieg, sie wollten die Kaskaden-Struktur. Dem hat die Bundeskanzlerin schließlich zugestimmt, sie hat sich damit exakt den eingebauten Puffer abhandeln lassen. Das ist eine Punktlandung, ein Verhandlungsergebnis, vor dem man nur den Hut ziehen kann.
Mit diesem sehr speziellen Verständnis von „schnellstmöglicher Ausstieg“ hat die Bundesregierung eine Volte geschlagen. Dieses Kriterium einte spontan im März und April beinahe alle gesellschaftlichen Gruppen, von den Kirchen bis zu sämtlichen Oppositionsparteien. Unter ‚schnellstmöglich‘ verstanden die aber ‚so schnell wie versorgungstechnisch möglich‘. Das Verständnis der Bundesregierung ist demgegenüber ‚so schnell wie möglich, ohne das Eigentumsschutzrecht (für Kernkraftwerke) gemäß Art. 14 (3) GG allzu arg zu verletzen’. Die Volte ist konfliktträchtig. Volker Hauff, Mitglied der Ethik-Kommision, hat deshalb auf die Frage „Die Kanzlerin spricht ... vom schnellstmöglichen Ausstieg“ geantwortet „Nein, das ist nicht der schnellstmögliche, das ist der gemütlichste Ausstieg.“ und hat ergänzt „... die Bundesregierung hat kein Recht mehr, sich auf die Arbeit der Ethikkommission zu berufen.“
So tief ist der Graben inzwischen. Als zentral für die Bestimmung von ‚schnellstmöglich’ erweist sich nun der Konflikt mit dem Eigentumsschutz nach Art. 14 (3) GG. Der Rest-Kapitalwert der Reaktoren gilt sakro-sankt. Ein schrittweiser Ausstieg gemäß dem technisch Möglichen wäre nur darstellbar, wenn von dem Anspruch auf Amortisation über 32 Jahre nach unten abgewichen würde.
Ein solches Abweichen nach unten wäre nicht per se illegitim. Zur Begründung halte ich als gelernter Ökonom die folgende Argumentation für fachlich korrekt. Ausgangspunkt ist die neue Risiko-Einschätzung nach Fukushima, wie sie die Bundeskanzlerin in ihrer Begründung der Entscheidung für den Kurswechsel am Montag, den 14. März, betont hatte. In wirtschaftliche Kategorien übersetzt bedeutet eine erhöhte Einschätzung des Risikos einen erhöhten Bedarf an Sicherheitsaufwendungen, unveränderte Qualität des Produkts, der Elektrizität, unterstellt; den erhöhten Bedarf an Sicherheitsaufwendungen zu bestimmen, war Sinn des Prüfauftrags an die RSK. Deren Bericht vom 14. Mai gibt einen Eindruck sowohl vom festgestellten Nachrüstbedarf als auch von dem, was ‚noch im Busche’ ist, weil in der kurzen Frist in etlichen Fällen bislang keine abschließenden Feststellungen getroffen werden konnten. Die Offenbarung bislang nicht gesehener Risiken mindert den Vermögenswert eines bestehenden Kernkraftwerks. Ein verminderter Vermögenswert übersetzt sich in eine verminderte zu fordernde Mindestamortisationszeit. Dass die Bundesregierung diese Argumentation vertritt, wäre von ihr zu erwarten, wenn denn die Worte vom 14. März und später (geldwertes) Gewicht haben sollen.
Realität aber ist: Sie tut es nicht. Warum wohl? Nach Art. 14 Abs. 2 gilt: „Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich der Allgemeinheit dienen“ – wann, wenn nicht nach Fukushima, sollte man ihn heranziehen dürfen? Die Wahrnehmung seitens der Politik ist jedenfalls, dass sie, im Rahmen der bestehenden (west-)deutsch (geprägt)en Rechtskultur, Abs. 2 keine rechte Durchschlagskraft zutraut. Deswegen, so meine Vermutung, meint die Bundesregierung, das Restrisiko der KKW-Nutzung bis zur bitteren Neige, also unverändert, wie im Juni 2000 vereinbart, den Bürgern zum Aushalten auferlegen zu müssen. Und das auch noch angesichts dessen, dass der Bund mit der 12. Novelle zum AtG, also Ende 2010, das Risiko einer Haftung für einen eventuellen Extra-GAU von den Ländern auf seinen Haushalt übernommen hat. Das Risiko, in einen Konflikt mit der (westdeutsch geprägten) Rechtskultur um den Eigentumsbegriff zu geraten, erweist sich als schwerwiegender als das Restrisiko der Kernkraftwerke in Deutschland. So anscheinend die Einschätzung der Pastorentochter aus dem sozialistisch geprägten östlichen Teil Deutschlands. Und sie wird sich ihren Teil zum noch ausstehenden Lernbedarf im Prozess der Vereinigung denken. Und kein Wort dazu öffentlich sagen.
Jochen Luhmann, Wuppertal Institut



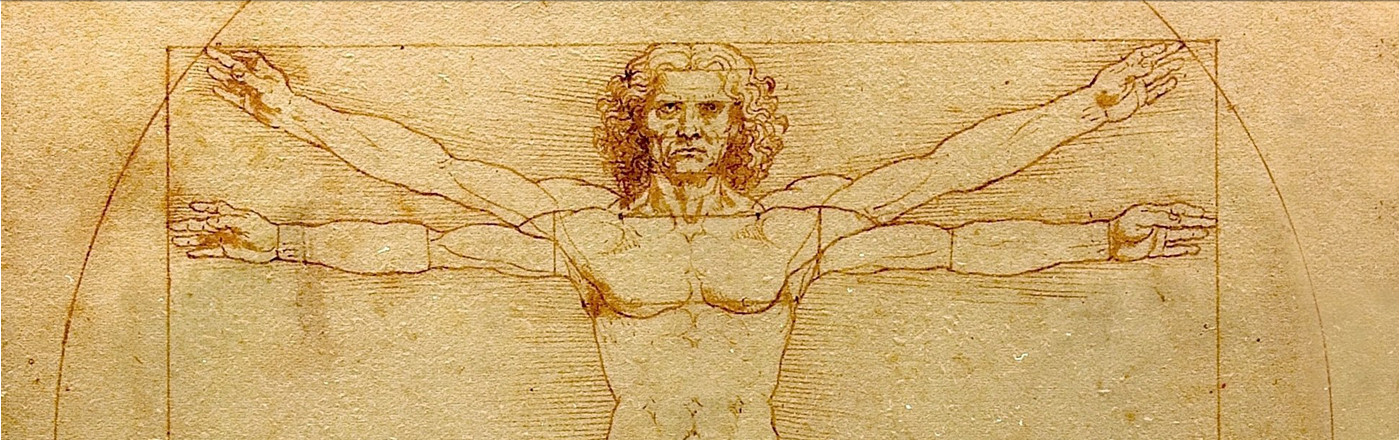





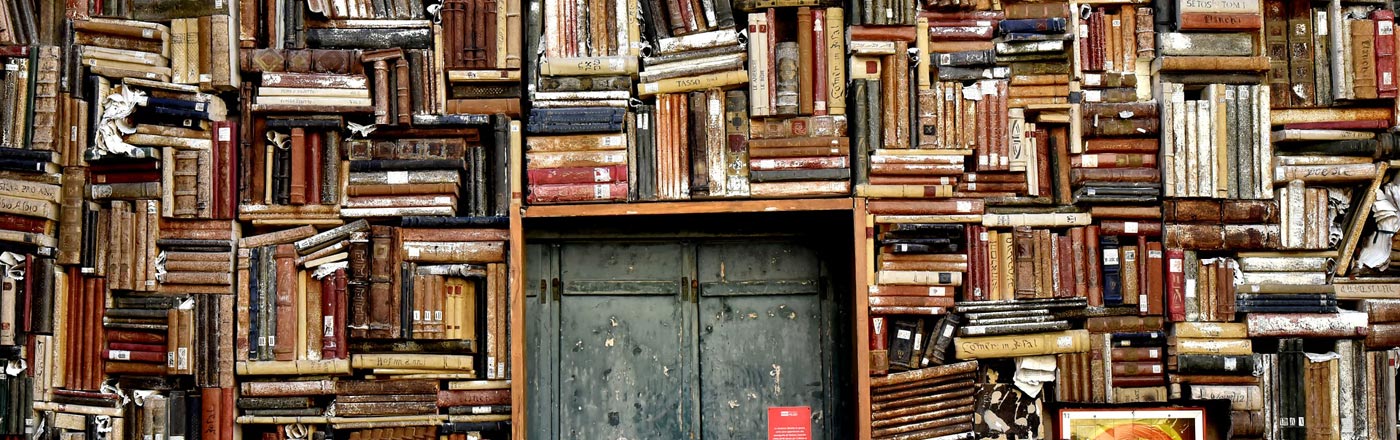


Anna Ijjas
am 18.07.2012In the face of this situation, Polkinghorne argues for giving up the idea of both universal rationality and universal epistemology. However, the measurement problem only states that we do not understand the relation between quantum and classical phenomena. It is far from being evident why the lack of understanding in this particular case should be accepted as the norm for rationality simpliciter. Even if we stop asking "Why it is reasonable?", in order to accept an answer to the question "What makes you think that might be the case?", we still need a universal rule of discourse -- be it a pragmatic one.
On the other hand, giving up the idea of universal rationality has serious consequences for the interdisciplinary dialogue; if different fields of experience presuppose different kinds of rationality, the relation between science and religion might be more properly described in terms of a NOMA-like model à la Gould, implying -- in some cases -- radical incommensurability.
Therefore, instead of giving up the idea of universal rationality, I suggest that we recognize quantum theory as a challenge to reconsider our idea of universal rationality. That is to say, I suggest that we do not accept the apparent insolubility of the measurement problem, but continue to seek for understanding.