
Wenn die Welt viral geht: Viren und ihr Einfluss auf das Leben
Leitartikel von Mirjam Schilling
Vor etwas mehr als 100 Jahren haben wir sie zum ersten Mal beschrieben: Die Viren. Krankheitserreger, die so klein sind, dass man sie damals nicht aus einer Lösung filtern konnte, wie das eben, im Gegensatz, für Bakterien möglich war. Virus, der lateinische Name für Gift, beschreibt dann auch schon treffend, wie wir sie wahrnehmen: als Leidverursacher und Übel, das Schaden anrichtet. Die vergangenen Pandemien, die uns noch lebhaft vor Augen stehen, scheinen das zu bestätigen. Umso überraschender sind dann aber vielleicht so manche Erkenntnisse, die wir durch die besseren technischen Möglichkeiten in den letzten Jahrzehnten über Viren gewonnen haben.
Beispielsweise, wie viele Viren es eigentlich auf diesem Planeten so gibt. Groben Schätzungen zufolge findet man alleine in einem Milliliter Tiefseewasser drei Millionen Viren, in einem Milliliter Meerwasser im Küstenbereich sogar dreihundert Millionen. Das entspricht einer geschätzten Gesamtmenge von 1 x 1030 Viren in allen Weltmeeren zusammen, oder dem Gewicht von fünfundsiebzig Millionen Blauwalen. Die meisten dieser Virusfamilien, insbesondere die, die uns Menschen nicht betreffen, haben wir dabei noch nicht einmal bewusst wahrgenommen, geschweige denn charakterisiert. Da könnte man sich fragen: Wo kommen alle diese Viren denn eigentlich her? Welchen Einfluss hatten und haben diese winzigen Bestandteile auf die Welt, in der wir leben? Und haben sie nicht vielleicht sogar wichtige Funktionen in unseren Ökosystemen?
Zurück zum Ursprung
Obwohl der Ursprung von Viren nicht schlussendlich geklärt werden kann, gehen alle gängigen Modelle davon aus, dass Viren das Leben schon so lange begleiten, wie es Leben eben gibt. Eine mögliche Erklärung für ihre Existenz ist, dass sie „Abfallprodukte“ erster zellulärer Systeme sind. Zellen könnten sich beispielsweise zu einfachen parasitären Vorstufen zurückgebildet haben. Womöglich haben sich auch einzelne Gene dieser Zellen selbständig gemacht. Andere Theorien, die nicht weniger wahrscheinlich sind, handeln Viren sogar als einfache Vorläufer von dann deutlich komplexeren zellulären Systemen. In diesem Szenario wären Viren also direkt an der Entstehung von Leben beteiligt gewesen. Wie auch immer Viren entstanden sind. Womöglich auch auf alle drei Arten. In jedem Fall begleiten sie uns aber schon unser Leben lang und seit es das Leben eben gibt.
Welche Rolle spielen Viren denn dann in unserer Welt? Wie haben sie die Welt, wie wir sie heute kennen geprägt? Erschöpfend ist das mit unserem jetzigen Wissensstand natürlich nicht zu beantworten. Aber einige beispielhafte Entdeckungen beschreiben eine Reihe von vermutlich zentralen Mechanismen, die uns einen Einblick geben können, wie Viren unsere Welt mitgeformt haben.
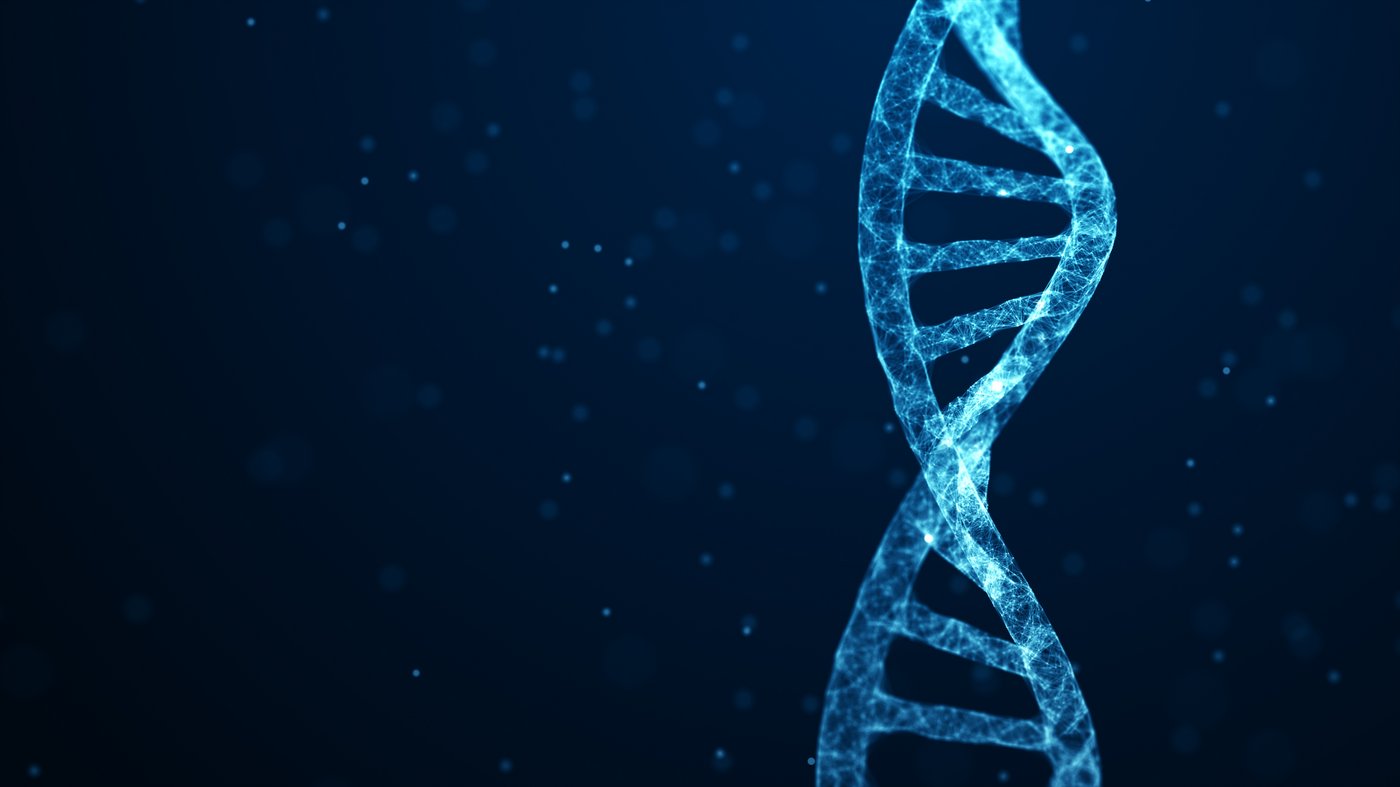
Geprägtes Menschsein
Viren sind Parasiten. Sie sind darauf angewiesen, die Mechanismen in der Wirtszelle für die eigene Vermehrung zu nutzen. Sie sind keine Lebewesen und treffen keine bewussten Entscheidungen über ihre Verbreitung oder Lokalisation. Erfolg und Misserfolg ihrer Vermehrung sind rein statistische Ereignisse. Können die Viruspartikel in die fremden Zellen eindringen? Passen die Werkzeuge der Wirtszelle genau genug, um neue Viruspartikel anhand der mitgelieferten Baupläne zu konstruieren? Ist der angestoßene Prozess so unauffällig, dass das Immunsystem des Wirts nicht alarmiert wird? Wie schnell gelingt der Austritt neuer Viruspartikel aus der Zelle? Und haben zufällige Fehler beim Kopieren des viralen Erbguts zu einer besser an den Wirt angepassten Virusvariante geführt?
Durch diesen parasitären Lebensstil üben Viren beständig Druck aus. Zum einen, Druck auf das Immunsystem des Wirts. Das Virus gewinnt, wenn es entkommt, der Wirt überlebt, wenn das Immunsystem das Virus identifiziert und eliminiert. Aber auch Druck auf alle anderen zentralen Prozesse in den Zellen. Denn die sind es ja, auf die die Viren für ihre Vermehrung angewiesen sind. Wie stark sich unsere Zellen durch diesen beständigen und immer wiederkehrenden Druck im Lauf der Zeit verändert haben, ist natürlich schwer zu sagen. Dass die hervorgerufenen Veränderungen aber eher größeren als kleineren Ausmaßes sind, kann man sich denken. Eine Studie schätzt, dass Viren womöglich für annähernd 30% aller anpassenden Veränderungen in den Bausteinen des menschlichen Proteoms (die Gesamtheit aller Eiweiße), das in Säugetieren konserviert ist, verantwortlich sein könnten. Der Mensch, wie wir ihn heute kennen, funktioniert vermutlich also nur so, wie er nunmal gerade funktioniert, weil es Viren gibt.
Viren und Ökosysteme
In größerem Stil üben Viren aber auch Druck auf ganze Ökosysteme aus. Denn die Infektion eines einzelnen Bestandteils im Ökosystem wird sein Verhalten beeinflussen, oder das der anderen Mitspieler. Sobald sich ein Bestandteil eines Ökosystems verändert, müssen sich auch alle anderen anpassen. Infektionen, die zum Tod führen, oder die Vermehrung des Wirts beeinflussen, verhindern, dass einzelne Spezies im Ökosystem Überhand nehmen. Gegenwart oder Abwesenheit einer Tier- oder Pflanzenart können wiederum die Beschaffenheit, Hierarchien und den Aufbau eines ganzen Ökosystems massiv beeinflussen. Die Nahrungskette verändert sich, biologische Nischen entstehen. Viren betreffen immer alle Mitglieder eines Ökosystems. Nicht nur den Infizierten. Die Veränderungen, die Viren hervorrufen haben interessanterweise aber nicht nur Einfluss auf die Lebewesen des Ökosystems, sondern auch auf Flora und Fauna. Kaum vorstellbar? Hier ein Beispiel: Eine Rinderpest im 19. Jahrhundert reduzierte die Zahl der Rinder in Zentralafrika so dramatisch, dass der Weidedruck stark nachließ. Dadurch war das Buschland verstärkt dem Umgreifen von Bränden ausgesetzt und verwandelte sich in eine Graslandschaft. Als eine Impfung den Rinderbestand vor dem tödlichen Verlauf der Viruserkrankung schützte, entwickelte sich die Landschaft wieder zurück zur Buschlandschaft. Gegenwart oder Abwesenheit von Viren betrifft also immer die Zusammensetzung des ganzen Ökosystemen. Auch die uns liebgewordenen Ökosysteme sehen also nur deshalb so aus, wie sie aussehen, weil es darin eben auch Viren gibt. Es ist natürlich unklar, wie unsere Ökosysteme ohne Viren aussehen würden, aber es ist auch klar, dass es unsere Umwelt nur mit Viren gibt. Wenn wir unseren Planeten also als schön beschreiben, dann beschreiben wir dabei auch immer die Viren mit.

Recycling und andere nützliche Eigenschaften
Viren sind interessanterweise auch daran beteiligt, wichtige Nährstoffe zu recyclen und zur Wiederaufnahme durch Tiere oder Pflanzen vorzubereiten. Wir kennen dazu Beispiele aus dem Erdreich, aber auch aus dem Meer. Manche Viren besitzen Werkzeuge, durch die große Makromoleküle auf kleine Untereinheiten heruntergebrochen werden können, sodass diese dann von anderen Lebewesen aufgenommen und wiederverwendet werden können. Abgestorbenes Plankton würde ohne die Zersetzung durch Viren in tiefere Meeresschichten absinken, und Nährstoffe damit für Jahrtausende dem Kreislauf entzogen. Viren tragen dadurch entscheidend zur Entstehung und zum Erhalt der Artenvielfalt bei.
Aktuellen Schätzungen nach müssen Viren dem Wirt auch nicht immer nur zum Nachteil gereichen. Denn vermutlich haben die meisten Viren zunächst erstmal überhaupt keine Auswirkungen auf ihren Wirt. In manchen Fällen können sie sogar einen Vorteil mit sich bringen. Aus dem Pflanzenreich sind einige Beispiele bekannt, in denen Infektionen mit bestimmten Viren einen Überlebensvorteil sichern. Reis, der mit BMV (brome mosaic virus) infiziert ist, ist beispielsweise deutlich resistenter gegenüber Trockenheit als nichtinfizierter Reis. Mit ZYMV (zucchini yellow mosaic virus) infizierter Weißklee ist deutlich weniger anziehend für Käfer als uninfizierter Weißklee.
Viren und ihre Mitbringsel
Viren können also durchaus etwas mitbringen. Ob das, was sie bringen von Vorteil ist oder nicht, kann von den Umständen abhängen. Was sie aber auf jeden Fall tun, ist genetisches Material zu transportieren. Denn sie bestehen ja im Wesentlichen aus Erbgut. Im Rahmen ihres Vermehrungsprozesses in der Wirtszelle, können manche Virusfamilien auch Teile ihrer genetischen Informationen im Erbgut des Wirts hinterlassen. In Umständen, in denen dieses dann in die Keimbahn (Abfolge von Zellen, die zur Bildung von Eizellen und Spermien führen) gelangt, wird es an die kommenden Generationen weitervererbt. Alle Lebewesen haben dadurch im Verlauf der Evolution hinweg immer größere Mengen dieser Sequenzen aus dem Erbgut von Viren angesammelt. Dies war eine der größten Überraschungen, die bei der Entschlüsselung des menschlichen Erbguts zutage kam. Dass das nicht ohne Folgen geblieben sein kann, ist einleuchtend. Was bewirken nun aber diese vielen Sequenzen?
Obwohl es bestimmt auch viele Überreste solcher Virus-Sequenzen gibt, die in unserem Erbgut keinerlei Funktion erfüllen, gibt es durchaus eine Reihe von inzwischen gut beschriebenen Beispielen, in denen sich unsere Zellen diese Sequenzen zunutze gemacht haben. Da gibt es zum einen Sequenzen, die für ein spezifisches Produkt kodieren. Das heißt, die abgelesene DNA wird in ein Eiweiß übersetzt, das dann spezifische Aufgaben in der Zelle übernehmen kann. Ein sehr bekanntes Beispiel ist ein Protein, das Syncytin heißt. Im Virus ist es dafür zuständig, beim Verschmelzen der Virushülle mit der Zelle zu helfen, sodass das Virus in die Zelle aufgenommen wird. Im menschlichen Körper erfüllt es nun eine wichtige Funktion, wenn es um die Verschmelzung von zwei Zellschichten in der Plazenta geht, die für die Ausbildung einer Schwangerschaft benötigt werden. Wird zu wenig dieses Proteins gebildet, kann es zu schweren Komplikationen im Verlauf der Schwangerschaft kommen. Ein anderes Beispiel sind die Proteine Rag1 und Rag2. Unser Immunsystem nutzt sie dazu, durch Genumlagerungen eine sehr viel größere Menge an verschiedenen Antikörpern produzieren zu können, als wir Gene dafür besitzen. Nur so können wir die große Menge an unterschiedlichen Krankheitserregern, mit denen wir konfrontiert sein können, spezifisch bekämpfen.
Es gibt aber auch Sequenzen, die regulatorische Funktionen haben. Viren und ihr Erbgut sind klein und müssen ihre Kodierkapazität schließlich effizient nutzen. Auch solche Sequenzen sind im Verlauf der Evolution im Erbgut aller Lebewesen zurückgeblieben. Wie menschliche Zellen diese Sequenzen nutzen, ist bisher noch eher schlechter erforscht. Aber es wird spekuliert, dass diese regulatorischen Elemente dazu dienen können, große Netzwerke an zellulären Mechanismen zeitgleich anzusteuern, um Prozesse schnell und effizient an-, ab- und umzustellen. Virussequenzen hätten so also womöglich überhaupt erst komplexe Lebewesen ermöglicht. Denn nur durch eine größere Menge an Genen wird ein Lebewesen noch lange nicht zwingend komplexer. Das Erbgut von Reis besteht nämlich zum Beispiel aus mehr Genen als das des Menschen. Trotzdem würden zumindest wir behaupten, dass der Mensch der komplexere Organismus ist. Zugegebenermaßen wissen wir allerdings auch nicht, was der Reis dazu denkt.

Vom Krankheitserreger zum Lehrmeister
Die angeführten Beispiele zeigen, auf welch vielfältige Art und Weise, Viren unsere Welt geprägt und verändert haben, und dies auch weiterhin tun. Wir haben hier nur ein paar einzelne Beispiele betrachtet. Vieles, was Viren zu der Welt, wie wir sie kenne, beitragen, ist außerdem noch unentdeckt. Die Entdeckung von Viren hat uns damit auf eine neue Entdeckungsreise geschickt. Mit ihnen und durch sie lernen wir eine neue Ebene unserer Welt kennen, Verknüpfungen zwischen Ökosystemen, aber auch evolutionäre Verbindungen für uns selbst. Viren haben unsere Welt und wie sie heute funktioniert entscheidend mitgeprägt und gestaltet. Ihre An- oder Abwesenheit wird auch in Zukunft unseren Planeten weiter formen.
Die Entdeckung von Viren hat uns damit aber zugleich auch noch auf eine weitere Entdeckungsreise geschickt. Was wir über Viren und ihren Beitrag zum Leben lernen, berührt auf unterschiedlichste Art und Weise auch unsere großen Lebensfragen. Was ist eigentlich Leben? Wie definieren wir Leben? Wo beginnt und endet Leben? Biologisch betrachtet werden Viren nicht zu den Lebewesen gezählt, weil sie keinen eigenständigen Stoffwechsel haben. Sie sind immer auf den Stoffwechsel der Wirtszellen angewiesen. Aber je mehr Viren wir kennenlernen, desto dünner wird diese Argumentation. Inzwischen kennen wir sogenannte Riesenviren, die zunächst sogar für Bakterien gehalten wurden, weil sie so groß sind, dass man sie unter einem Mikroskop sehen kann. Neben der Größe besitzen sie aber auch gleichzeitig so viele eigene Werkzeuge, dass sie in nur sehr, sehr wenigen Punkten noch von ihren Wirtszellen abhängig sind. Und da es auch Bakterien gibt, die von bestimmten Produkten ihrer Wirtszellen abhängig sind, wird die Grenze zwischen tot und lebendig - zumindest biologisch gesehen - immer dünner. Wenn nun aber die biologische Grenze gar nicht so eindeutig ist, wie definieren wir dann Leben? Braucht es dann nicht vielleicht einen Informationsrahmen, der unabhängig von den Grenzen der Naturwissenschaft agieren kann? Nicht auf alle Fragen des Lebens werden wir in der Naturwissenschaft Antworten bekommen. Dies sollten wir im Hinterkopf behalten. Insbesondere, wenn wir die Frage nach dem Leben weiterdenken. Was ist schützenswertes Leben? Ab wann ist jemand eine Person? Bin ich mehr als nur die Summe meiner biologischen Komponenten? Biologie und Naturwissenschaft kommen hier womöglich zu unterschiedlichen Antworten. Zur biologischen Komplexität hat sich eine philosophische und theologische Komplexität gesellt.
Wir haben außerdem gelernt, dass wir biologisch gesehen unter anderem auch aus den Überresten von Viren bestehen. Wie denken wir über den Menschen und seinen Wert im Angesicht der Viren, durch die wir gestaltet sind? Wir laufen in Gefahr, vorschnell den negativen Beigeschmack, den Viren in unserem Empfinden mit sich bringen, auf den Wert des Menschen zu übertragen. Einseitiges Wissen über Viren birgt die Gefahr, dies biologisch über zu interpretieren. Ausgewogenes Verständnis von Viren zeigt, dass Viren uns mit anderen Ökosystemen verbinden. Sie bilden die biologische Verbindung zur restlichen Schöpfung und weisen uns unseren Platz zu. Wir sind Teil der Schöpfung und sitzen mit ihr in einem Boot. Aber wir können unser Wissen über die Verbindungen zwischen den Ökosystemen und ihre einzelnen Funktionsweisen auch nutzen. Das befähigt uns, unsere Aufgabe als Verwalter verantwortlich wahrzunehmen.
All diese Beobachtungen verleihen auch unserer Interpretation davon, ob wir Viren als gut oder böse, als Segen oder Fluch betrachten, eine subjektive Note. Nur weil ein Virus einen negativen Effekt auf mein Leben hat, muss das noch lange nicht global gelten. Für eine andere Spezies mag dasselbe Virus womöglich von Vorteil sein. Auf die allermeisten Lebewesen hat es womöglich überhaupt keinen Einfluss. Wir können unsere Welt auch nicht einfach in ein vor- und nach-Virus-Zeitalter einteilen und diese als eine Konsequenz des Sündenfalls abtun. Biologisch betrachtet ist es sehr wahrscheinlich, dass Viren an der Entstehung von Leben beteiligt waren. Und selbst wenn nicht, haben Viren unsere Welt geprägt, seit es Leben gibt. Sie sind verantwortlich für beides, die Schönheit, die wir sehen, aber auch das Leid, das sie verursachen können. Sie einfach als natürliches Übel abzutun, greift zu kurz. Sie fordern uns heraus, natürliches Übel und wie wir darüber denken zu interfragen. Natürliches Übel hat eine subjektive Note, und Viren zeigen uns, dass wir es nicht einfach gleich behandeln können, wie moralisches Übel. Wenn dem so ist, wie denken wir dann über Schuld und den Sündenfall? Wie haben wir die Dinge bisher interpretiert? Müssen wir irgendwo umdenken? Und was macht das dann mit unserem Umgang mit Leid? Können wir hier etwas lernen, das uns auch pastoral hilft, an der Seite von Leidenden zu sein und sie besser zu unterstützen?
Viren erweitern unseren Horizont. Nicht nur biologisch, sondern auch philosophisch und theologisch. Viren zeigen, dass es spannend wird, wo neue Details dieser physischen Welt unsere großen Lebensfragen berühren. Und wir sind noch nicht am Ende. Es gibt noch viel zu entdecken. In der Welt der Viren, aber auch theologisch und philosophisch.
Mirjam Schilling
Publiziert im Oktober 2023
Mirjam Schilling ist Virologin und promoviert im Fachbereich Science and Religion an der Fakultät für Theologie der Universität Oxford.
Literatur
Breitbart, M., C. Bonnain, K. Malki, and N. A. Sawaya. 2018. "Phage puppet masters of the marine microbial realm." Nat Microbiol 3 (7):754-766. doi: 10.1038/s41564-018-0166-y.
Enard, David, Le Cai, Carina Gwennap, and Dmitri A. Petrov. 2016. "Viruses are a dominant driver of protein adaptation in mammals." eLife 5:e12469. doi: 10.7554/eLife.12469.
French, Rebecca K., and Edward C. Holmes. 2019. "An Ecosystems Perspective on Virus Evolution and Emergence." Trends Microbiol. doi: 10.1016/j.tim.2019.10.010.
Koonin, Eugene V., and Valerian V. Dolja. 2013. "A virocentric perspective on the evolution of life." Curr Opin Virol 3 (5):546-57. doi: 10.1016/j.coviro.2013.06.008.
Roossinck, M. J., and E. R. Bazan. 2017. "Symbiosis: Viruses as Intimate Partners." Annu Rev Virol 4 (1):123-139. doi: 10.1146/annurev-virology-110615-042323.
Bildnachweis
Earth concept as coronavirus Sars CoV 2 on white background. 3D Render. Showing Europe (c) Adobe Stocks #337063032
Abstract 3d polygonal wireframe DNA molecule helix spiral on blue. Medical science, genetic biotechnology, chemistry biology, gene cell concept. Medical science background. (c) Adobe Stocks #334428066
The Earth viewed from the orbit - Element of this image from Nasa Public Domain (c) Adobe Stocks #546018479
creative collage of biodiversity in the form of an animal, ecosystem and protection of nature and aquatic environment. Generated AI (c) Adobe Stocks #610985191
Diesen Beitrag fand ich...
Sind Viren wichtig? Und was lässt sich daraus lernen?
Diskussion zum Leitartikel von Mirjam Schilling
Ihre persönlichen Schlussfolgerungen: was lehren uns die Viren?


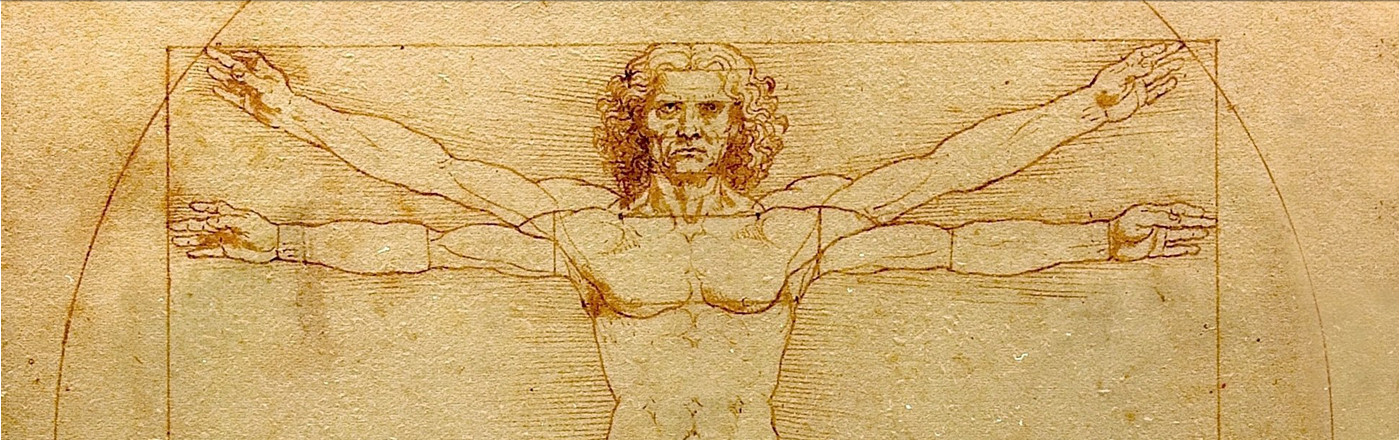








Kommentare (0) Keine Kommentare gefunden!