Das Zusammenspiel von Technik, Religion und Mission in Indien
Leitartikel von Axel Siegemund
Vielleicht ist es bezeichnend, dass er Indien bereits als Augustiner-Generalprior kennen gelernt hat. Ich spreche von Robert Francis Prevost. Inzwischen bezeichnet er sich als Leo XIV. – und begründet diesen Namen damit, dass uns die Künstliche Intelligenz heute in ähnlich revolutionäre Zeiten versetzt wie die Menschen zur Zeit Leos XIII. Es gibt aber mindestens zwei Differenzen zur Situation am Ende des 19. Jahrhunderts. Erstens steht im Zentrum der heutigen technischen Revolution nicht die Chemieindustrie und zweitens wird ihr Rhythmus nicht von einer protestantischen Arbeitsethik deutscher Prägung vorgegeben. Ich meine, die Zukunft der globalen Technologiegesellschaft wird durch das Zusammenspiel zwischen Digitalität und Religiösität bestimmt – und Indien hat die Chance darauf, beides in nie dagewesener Weise zusammen zu führen.
In Indien können wir heute schon beobachten, was es heißt, in einem digitalen Zeitalter religiös zu sein. Technologien erleichtern hier nicht nur die Ausübung von Religion, sie klären vor allem darüber auf, was ein religiöser Glauben in unserer Zeit überhaupt sein kann.
Demzufolge gibt es hier ein reiches Feld [1], das 2023 mit einer Tagung am IIT Madras 2023 weiter erforscht worden ist.[2] Beobachtungen dieser Tagung sind: Technik fördert Religion ganz praktisch (1.), sie vermittelt Heilszusagen (2.) und verstärkt Prozesse wie Globalisierung (3.) und ökologisches Denken (4.). Schließlich folgt sie einem Universalisierungsanspruch und erweist darin auch außerhalb Europas ihren christlichen Ursprung (5.).
1. Baukunst und Wasserversorgung
Dass die strenge Trennung zwischen dem Heiligen und dem Profanen durch vernetzte Beziehungen zwischen Technik und Religion in Frage gestellt wird, ist kein Unfall, sondern Inspirationsquelle für viele Ingenieursprojekte in ganz Südostasien. Technologien dienten immer schon dem Kulturaustausch und religiösen Zwecken gleichermassen.
Antike Bauwerke wie der Brihadishvara-Tempel oder der Konark-Sonnentempel sind Meisterwerke der Baukunst, die die wissenschaftlichen und mathematischen Fähigkeiten ihrer Zeit in Verbindung mit spiritueller Hingabe verkörpern.
Ein klassisches Beispiel bietet die Wasserversorgung. In Südindien spiegelt sie die spirituelle Bedeutung des Wassers wider. Tempelarchitektur und Wasserressourcenmanagement sind hier immer eng miteinander verbunden, da Wasser auch für spirituelle Praktiken unverzichtbar ist. Südindische Tempel, die oft in der Nähe von Flüssen, Seen oder Wassertanks erbaut wurden, zeugen von ausgefeilter Versorgungstechnologie. Die Flüsse Kaveri, Godavari und Vaigai bieten wichtige Ressourcen, und die Tempel in ihren Einzugsgebieten verfügten über komplexe Systeme zur Wasserspeicherung und -verteilung. Becken (Pushkarini) wurden als integraler Bestandteil des Tempelkomplexes angelegt. Diese Becken dienten nicht nur der rituellen Reinigung, sondern auch als Reservoirs für Trinkwasser und Bewässerung, als Hochwasserschutz und materiale Grundlage für den Tempeldienst. Die Gestaltung der Bauwerke könnte durch das Vastu Shastra beeinflusst worden sein, das Gewässer in glückverheißende Richtungen ausrichtet. Kanäle und Wassergräben leiteten Flusswasser in Tempelbecken um und zeugen so von fortschrittlicher Ingenieurskunst. Beispielsweise weisen der Brihadishvara-Tempel in Thanjavur und der Meenakshi-Tempel in Madurai aufwendige Wasserbauwerke auf.

Technische Systeme betonen aber nicht nur die Heiligkeit natürlicher Ressourcen; sie fördern auch das Bewusstsein für deren Erhaltung. Rituale und Feste wie Theerthavari (eine Wasserprozession) unterstreichen die Verbindung zwischen Lebensquell, Gemeinschaft und Divinität. Sie verankern den verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt in der religiösen Praxis.
Auch im heutigen Indien findet moderne Technik im religiösen Kontext Anwendung. Bei der Restaurierung und Erweiterung religiöser Stätten kommen Bautechnologien zum Einsatz. Der Akshardham-Tempel in Delhi, ein Wunderwerk der Architektur, vereint aufwendige Schnitzereien mit nachhaltiger Bauweise. Ebenso erfordern Großveranstaltungen wie die Kumbh Mela [3], die weltweit größte religiöse Versammlung, eine sorgfältige Planung, Baukunst und logistisches Know-how, um Millionen von Gläubigen unterbringen zu können. Selbstverständlich wird digitale Technologie in der religiösen Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt, etwa um virtuelle Tempelbesichtigungen, Online-Gottesdienste und die Übertragung spiritueller Veranstaltungen zu ermöglichen. Und selbstverständlich reist man nicht nur zu Fuß.
2. Dharma, KI und Heilsvermittlung
Wer schon einmal von Berlin nach Mumbai geflogen ist, der weiß, was es heißt, von der säkularen Stagnation in ein dynamisches, hochreligiöses Land einzutauchen. Die Architektur des internationalen Flughafens in Mumbai ist nach einer riesigen Lotus-Blume gestaltet, wie sie auch in Tempelschnitzereien und der Palastarchitektur vorkommt. Das Terminal wurde von Zaha Hadid Architects entworfen, einem britisch-irakischen Architekturbüro, das auch für das Guangzhou Opera House verantwortlich zeichnet. Ihr Entwurf nutzt die Lotusblume als Leitmotiv mit einer Dachliniein Form von Blütenblättern, einem zentralen Atrium, das wie ein Teich angelegt ist, und Hallen, die sich in einer floralen Geometrie nach außen hin ausbreiten. Glasfassaden und gemusterte Gitterwände erinnern an Lotusblätter und Jaali (Gitterschirme). Sie filtern das Tageslicht in das Gebäude und halten es zugleich kühl. Im Innern ist der Flughafen von der Geschichte und Kultur Maharashtras inspiriert, wodurch ein rhythmisches, beruhigendes Reisen ohne überwältigende Pracht gewährleistet wird. In praktischer Hinsicht zeichnet sich das Design durch Nachhaltigkeit und Effizienz aus. Die Passagiere bewegen sich durch Räume, die kulturelle Tiefe vermitteln, von subtilen Mustern bis hin zu weitläufigen Atrien - ein Zeugnis für die globalen und religiösen Ambitionen Indiens. Verwurzelt in der Tradition, streckt es sich in eine Zukunft, die sich über ihre Herkunft hinwegsetzen kann.
Hier schlägt das Engineering eine Brücke zwischen dem Materiellen und dem Spirituellen. Die Symbiose spiegelt die Kontinuität des kulturellen Ethos Indiens wider. In ganz Südostasien entwickelt sich die Beziehung zwischen Technologie und „Dharma“ – der moralischen und spirituellen Pflicht, die im Zentrum der indischen Philosophie steht – auf tiefgreifende Weise. „Dharma“, das in alten Texten verwurzelt ist, bedeutet, in Harmonie mit moralischen und kosmischen Gesetzen zu leben. Technologie als ihr Instrument beeinflusst zunehmend, wie Hindus Dharma im täglichen Leben interpretieren und praktizieren, und schafft so eine dynamische Schnittstelle zwischen Tradition und Innovation. Auch digitale Plattformen haben die Zugänglichkeit und Ausübung des Dharma verändert. Tempel-Websites, mobile Apps und soziale Medien ermöglichen es Gläubigen, virtuell an Ritualen teilzunehmen, Pujas (spirituelle Dienste) durchzuführen und spirituelle Führung zu suchen.
Die Verschmelzung von Technologie und Religion wirft jedoch gewaltige ethische Fragen auf. Die Kommerzialisierung von Ritualen und spirituellen Dienstleistungen, wie kostenpflichtige Online-Darshans (Gottheitsbetrachtungen) oder ein VIP-Zugang zu Tempelritualen, stellt die Essenz des Dharma in Frage, das eigentlich Inklusivität und Selbstlosigkeit betont. Wie wird es möglich, das spirituelle Erbe Indiens weiter zu tragen und Grundwerte wie individuelle Verantwortung und Religionsfreiheit, die durch das Christentum hinzugekommen sind, in der vernetzten, digitalen Welt aufrechtzuerhalten?
Religionsfreiheit ist in der hinduistischen Tradition Indiens schon immer umstritten.[4] Wie können KI-Systeme heute ohne Vorurteile gegenüber einer Religion oder Weltanschauung entwickelt und eingesetzt werden? Wie werden unterschiedliche Traditionen oder benachteiligte Menschengruppen involviert? Algorithmen, die auf verzerrten Daten trainiert wurden, perpetuieren Diskriminierung und erschweren bestimmten Gruppen wie den Indigenen (Adivasi) und den Kastenlosen (Dalits) den Zugang zu Informationen oder Dienstleistungen.[5] Andererseits fördert KI Verständnis, indem sie den Dialog unterstützt und Instrumente für die spirituelle Ausdrucksfähigkeit schafft.
KI wirkt als hybride Einheit, die theologische Konzepte wie Unsterblichkeit, Erlösung und Allgegenwart in einen technologischen Rahmen integriert. Sie verändert die Art und Weise, wie die Menschheit Göttlichkeit und Transzendenz wahrnimmt. Glauben und Staunen werden durch algorithmische Vorhersagen und technologische Wunder transformiert. Die Black-Box-Natur von KI-Systemen verstärkt diese Dynamik noch und fördert sowohl Ehrfurcht als auch Angst vor ihrer Rolle im menschlichen Leben. Indem KI traditionelle religiöse Praktiken variiert, riskieren wir zugleich, das Wesen der Transzendenz zu schmälern.
Die Tagung in Madras, die im Rahmen einer deutsch-indischen Hochschul-Kooperation stattfand, zeigte deutlich, dass religiöse Riten immer auch als Demonstration von Handlungsmacht verstanden werden müssen und dass daher die Schnittstelle zwischen Religion und Technologie einen massiven Einfluss auf das soziale Gefüge hat. Die Ausübung von Ritualen auf digitalen Geräten steht heute auch im Zusammenhang mit Religionswechsel oder der zeitweisen Praktizierung eines säkularen Lebensstils.
Dabei gibt es keine besondere Affinität zu einer bestimmten Religion. Allerdings spielen kollektive Institutionen, Kultstätten, Riten und Bräuche eine wesentliche Rolle. Insbesondere hat Covid-19 den Einsatz von Technologie in Glaubens- und Religionspraktiken stark gefördert und individualisierte Herangehensweisen gestärkt. Jetzt passen sich die Religionen an und reagieren auf neue Weise auf individualisierte Glaubenswege, oft durch digitale Technologien.
3. Hinduismus global und universal
Ein Beispiel für die Digitalisierung hinduistischer Religionspraktiken bietet die Umwandlung des Shri Mahakaleshwar-Tempels in Ujjain/ Madhya Pradesh in einen digital vermittelten heiligen Raum. Das Zusammenspiel zwischen religiösen Ritualen und digitalen Plattformen verändert das Engagement der Gläubigen immens. Ein virtueller Darshan (d.h. Gottheitsbetrachtung) wird ebenso möglich wie die Teilnahme an Online-Ritualen. Dies erleichtert den globalen Zugang und stützt die von der Regierung Modi erwünschte Hinduisierung des Globus.[6] Dabei bleibt die traditionelle Verbindung zwischen Religion und Kommerz erhalten, wie das landesweit beim Diwali-Fest der Fall ist.
Das Digitale bringt nun neue Dynamiken der Inklusion, Exklusion und Hierarchisierung mit sich. Auch diskriminierende Vorstellungen von Reinheit und rituellen Codes werden im digitalen Raum reinterpretiert – und damit gefestigt.
Ähnliche Dynamiken verbinden sich mit dem Bada Mangal-Festes in Lucknow. [7] Das Zusammenspiel von Technologie und Transzendenz führt hier zu modernen Ausdrucksformen von Säkularismus und religiöser Harmonie. Bada Mangal symbolisiert die Verschmelzung von hinduistischen und muslimischen Traditionen durch eine Armenspeisung. Besonders Instagram verstärkt dieses transzendente Ethos, indem es die spirituellen und gemeinschaftlichen Aspekte der Speisung vermittelt und das ursprünglich lokale Ereignis in eine globale Erzählung verwandelt. Influencer wie Maroof Umer nutzen Instagram, um die Geschichte des Festivals, seine Werte und seine Rolle bei der Förderung des Säkularismus (=Gleichwertigkeit der Religionen) zu vermitteln und so geografische Grenzen zu überwinden und ein globales Publikum anzusprechen. Hashtags und visuelles Storytelling erleichtern die Konstruktion digitaler Gemeinschaften, in denen sich Nutzer durch die tiefere Bedeutung des Festivals verbinden. Die digitale Dokumentation macht es möglich, Güte und Großzügigkeit über physische und religiöse Grenzen hinweg zu zelebrieren, so dass Transzendenz auf inklusive Weise erlebbar und teilbar wird.
Es bleibt aber nicht dabei, dass der Hinduismus zu einer globalen Größe wird; er greift auch auf das Universum über. So ist das indischen Weltraumprogramm (ISRO) keineswegs frei von Religion und Ritualen. Vielmehr wird hier deutlich, dass die westliche Raumfahrt mit ihrer Sehnsucht nach unendlichen Weiten und ihrem Streben nach der Überwindung von Zeit- und Raumgrenzen christlichen Ursprungs ist. Wenn heute Raketen und Satelliten mit hinduistischen Ritualen verehrt werden, dann zeigen sich die religiösen Einflüsse auf die Wissenschaft im Westen umso deutlicher. So betonen indische Studien die fördernde Rolle der katholischen Kirche in der europäischen Astronomie [8] und die christlichen Rituale in der Weltraumforschung in Russland (!) und den USA. Dazu gehören sowohl Gebete bei der Mondlandung als auch Juri Gagarins Anmerkung, er habe Gott bei seiner Erdumrundung nicht getroffen. Sie erinnern an die Science-Fiction der Kolonialzeit, in der hinduistische Symbole und Erzählungen oft futuristische Visionen von Technologie prägten.[9] Aber auch in Indien hat sich die katholische Kirche bei der Gründung des indischen Weltraumprogramms hervorgetan, beispielsweise durch ihre Unterstützung bei der Umwandlung der St. Mary Magdalene Church in die erste Startstation der ISRO. Auch eine christliche Minderheit kann einen Rahmen zur Integration von Technologien in das soziokulturelle Milieu bieten.
4. Religion und Ökologie
Zurück auf die Erde: hier ist die Umweltkrise ein weiteres Thema, das die Religionen in Indien beschäftigt. Dabei geht es jedoch weniger um die religiösen Wurzeln der Umweltsorge (also Ökotheologie), sondern mehr um das gemeinsame Interesse von religiösen und technischen Playern heute (in Form einer Technoreligion).
Konkret wird diese Verknüpfung bei der Organisation von Pilgerreisen wie die Char-Dham-Pilgerreise in Uttarakhand. Hier spielt die digitale Steuerung eine entscheidende Rolle im Umgang mit den großen Pilgerzahlen zur Verbesserung der Sicherheit und zum Schutz der empfindlichen Umwelt im Himalaya. Die Echtzeit-Regulierung von Menschenmengen hat direkten Einfluss auf die ökologische Nachhaltigkeit und die lokale Klimaresilienz. Digitale Interventionen werden als proaktive Strategien für ein nachhaltiges Pilgermanagement angesichts ökologischer Herausforderungen eingesetzt. Auf der anderen Seite gibt es Gruppen, die aufgrund mangelnder digitaler Kompetenz Schwierigkeiten haben, an der Pilgerfahrt teilzunehmen. Die Char-Dham-Pilgerreise zeigt, wie in diesen konkreten Fällen das Ökologische und das Soziale zusammen zu denken und technisch zusammen zu führen sind.
5. Mission und kulturelle Einbettung
Technik und Religion begegnen sich in Indien im Modus der kulturellen Einbettung. Es gibt eine funktionale Zuordnung (Bau- und Wasserkunst), eine Verstärkung von Handlungsmacht durch technisch gestützte Rituale (Dharma, Pilgerreisen, Tempeldienst), eine Globalisierung der Religionskultur (weltweiter Hinduismus) und eine Integration von religiösem und technischem Denken zur Erlangung gemeinsamer Ziele (Ökologie).
Technik vergegenständlicht Weltreligionen in Weltkulturen, indem sie praktische Ausdrucksformen bereitstellt und religiöse Funktionen variiert, rekonstruiert und verstärkt.[10] Unmöglich ist es hingegen, diese Funktionen ausschließlich technisch zu erzeugen, weil die Technologie immer auf einen religiösen Bodensatz aufbauen muss. Transzendenzen sind zwar konstruierbar, ihr konstruktiver Charakter muss aber vor der vordiskursiven, erfahrenen Wirklichkeit zurücktreten, wenn er Wirkung entfalten soll. Religionen haben einen technischen Aspekt, aus dem sich z.B. ethisch-moralische Gemeinsamkeiten extrahieren lassen. Aber eine Harmonisierung etwa der Ethik des Hinduismus mit der des Christentums ist auch auf diesem Weg nicht durchsetzbar, weil KI und Soziale Medien die Differenzen ebenso verstärken wie die Gemeinsamkeiten.[11]
Die Positivität der historischen Religion mit ihren phänomenologisch gegründeten Erfahrungen wird technisch nicht durchbrochen – ebenso wenig wie die religiöse Selbstbestimmung nicht technisch, sondern politisch gefährdet ist. Allerdings liegt in der Universalisierung eine Gemeinsamkeit zwischen der Technik und dem Monotheismus: beide fragen über die eigene Kultur hinaus. Die Idee eines globalen Hinduismus ist ja Antwort auf jene Mission, die behauptet, dass alle Trägerinnen und Träger der Gottebenbildlichkeit grundsätzlich gleich sind.
Die kulturelle Verortung konkreter Religionen verändert sich also technisch, etwa durch den Buchdruck, den Bartholomäus Ziegenbalg zu Beginn des 18. Jahrhunderts nach Indien brachte. Ebenso hat die ärztliche Mission mit ihren Technologien das moderne Ayurveda beeinflusst.[12] Die Spannung zwischen Kontext und Universalisierung bleibt technoreligiös symbolisiert. Kastenlose bleiben in ihrem Stand, können sich aber nun leichter mit nichtlokalen Kulten identifizieren. Biographien lassen sich auch weiterhin nicht verallgemeinern, Technologien stellen aber Erweiterungen der eigenen Beheimatung bereit wie wir sie aus der christlichen Mission kennen. Thomas Menamparampil, der frühere Erzbischof in Guwahati/ Assam schreibt: „Es ist an der Zeit, dass der Westen den Osten und der Norden den Süden kennenlernt. Das Alte und das Neue müssen in einen Dialog treten. Der Handel muss ethische Werte berücksichtigen, und die wissenschaftliche und technologische Forschung muss sich von der spirituellen Suche inspirieren lassen."[13]
Sollen also unsere Technologien nicht unter dem Schein von Transzendenz doch nur zur Erhöhung unserer kollektiven Egos beitragen, dann müssen wir fragen, welche positive Erweiterung der je eigenen Identität die technoreligiös vorgestellte Wirklichkeit denn leisten kann. Dazu sind vielleicht ganz einfache, praktische Hinweise hilfreich: während in Delhi und Mumbai Millionen für die pränatale Diagnostik aufgewendet werden, fehlen auf dem Land Basistechnologien, um Kindern das Leben erhalten zu können. Wenn sich mit dem Fortschritt die Hoffnung auf Beseitigung dieser allseits vertrauten Verteilungsungerechtigkeit verbindet, dann, meine ich, geht es nicht um die bloße Vermittlung von Glaubensformen, sondern um einen Vorgeschmack auf das Heil selbst.
Axel Siegemund
Publiziert im Oktober 2025
Anmerkungen
[1] Lim, Francis Khek Gee, ed. Mediating piety: Technology and religion in contemporary Asia. Vol. 26. Brill, 2009; Srinivas, Tulasi.(2018). The Cow in the Elevator: An Anthropology of Wonder. Durham, NC: Duke University Press; Geraci, Robert M. (2018). Temples of Modernity: Nationalism, Hinduism, and Transhumanism in South Indian Science. Lanham, MD: Lexington Books; Jacobsen, Knut A. and Myrvold, Kristina, eds. (2018). Religion and Technology in India: Spaces, Practices and Authorities. London: Routledge; Subramaniam, Banu (2019). Holy Science: The Biopolitics of Hindu Nationalism. New Delhi: Orient BlackSwan; Thomas, Renny. (2021). Science and Religion in India: Beyond Disenchantment. Abingdon, Oxon: Routledge; Sinha,Vinita. (2023). Temple Tracks: Piety and Railway Construction in Asia. Oxford: Berghahn.
[2] Lourdusamy, John B./ Thomas, Renny and Siegemund, Axel (2026). Religion and Technology: New Perspectives in the Digital Age, New Delhi: Peter Lang.
[3] Lucia, Amanda (2023). Economies of Wonder: The Production of Spectacle at the Kumbh Mela, in: Wonder in South Asia, edited by Tulasi Srinivas, State University of New York, ch. 8.
[4] Schäfer, Klaus (2003): Hindu-Fundamentalismus, Hindu-Nationalismus, Kommunalismus? Religion und Gewalt in Indien, in: Anstoss Mission. Impulse aus der Missionstheologie, Frankfurt/Main, 2003; Malinar, Angelika (2019): Indiens "säkulare" Religion: Nationalistische Deutungen des Hinduismus.", in: F.W. Graf und J.-U. Hartmann (Hgg.). Religion und Gesellschaft. Sinnstiftungssysteme im Konflikt, Berlin/ Boston: de gruyter, 201-228.
[5] Siegemund, Axel (2017): „Digital India“: Accessibility und Usability als Ausdruck kollektiver Kommunikationsbedingungen im Internet of Things and Services (IoTS), in: M. Eibl und M. Gaedke. (Hgg.): INFORMATIK 2017. Lecture Notes in Informatics (LNI), Gesellschaft für Informatik, Bonn, DOI: 10.18420/in2017_128.
[6] Siegemund, Axel (2024): Der gnädige Algorithmus im Digitalkrieg der Religionskulturen in Europa, China und Indien. Theologie in der Gegenwart 67.3 (2024): 174-185.
[7] Vgl. L. Tiwary (2026): Food And Festival of Bada Mangal: Religious Syncretism through Instagram, in: Lourdusamy, John B./ Thomas, Renny and Siegemund, Axel (2026). Religion and Technology: New Perspectives in the Digital Age, New Delhi: Peter Lang.
[8] Vgl. Dipak Kr Chakraborty (2026): Religion, Rituals, and Techno-scientific Objects: Reading the Religious and Ritualistic Life of Space Program in India, in: Lourdusamy, John B./ Thomas, Renny and Siegemund, Axel (2026). Religion and Technology: New Perspectives in the Digital Age, New Delhi: Peter Lang.
[9] Lanzillo, Amanda. (2024). Pious Labor: Islam, Artisanship, and Technology in Colonial India. Berkeley: University of California Press.
[10] Siegemund, Axel (2022): Grenzziehungen in Industrie- und Biotechnik. Transzendenz und Sinnbehauptungen technologischer Modernisierung in Asien und Europa, Baden-Baden: Nomos.
[11] Vgl. auch Martin Mittwede (2013): Toleranz im Hinduismus, in: H. R. Yousefi und H. Seubert (Hgg.). Toleranz im Weltkontext: Geschichten - Erscheinungsformen - Neue Entwicklungen, Wiesbaden: Springer VS, 85–94.
[12] Grundmann, Christoffer H.(2002): Missionstheologische Probleme und Fragestellungen der ärztlichen Mission, in: Propach, Gerd (Hg.): Geht hin und heilt. Zeichen der Freundlichkeit Gottes, Porta Studien 20, Marburg: Francke. Mukharji, Projit Bihari. (2019): ‘Akarnan: The Stethoscope and Making of Modern Ayurveda, Technology and Culture 60 ( 4), 953–978.
[13] „Time has come for the West to meet the East, the North the South. The old and the new must dialogue. Commerce must be attentive to ethical values, and scientific and technological research must draw inspiration from spiritual search.“ Menamparampil, Thomas (2013): Becoming Bridge-Builders in Periods of Transition: Towards a Communion if Civilizations in our Times, in: Prajna Vihara, Volume 13, Number 1-2, January-December, 2012, 1-38, hier: 5. Übersetzt von DeepL.
Bildnachweis
- Famous Taj Mahal on sunset, view from the river Yamuna, Agra, India (c) Adobe Stocks 669263738 Von AlexAnton
- alle weiteren Bilder von Axel Siegemund
Diesen Beitrag fand ich...
Das indische Modell als Zukunft der globalen Technologiegesellschaft?
Die Zukunft der globalen Technologiegesellschaft wird durch das Zusammenspiel zwischen Digitalität und Religiösität bestimmt, meint unser Autor Axel Siegemund. Was denken Sie?



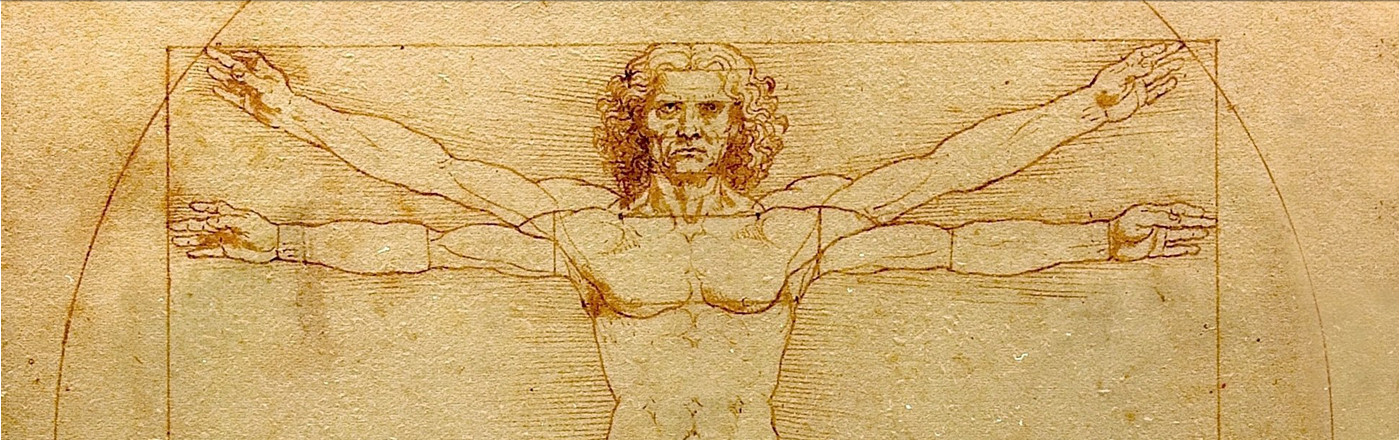





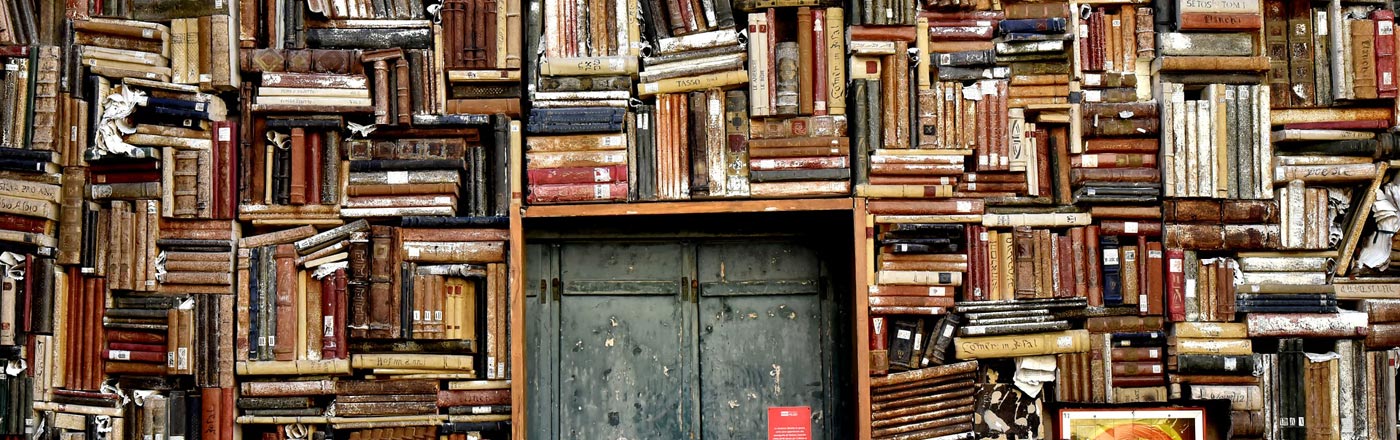


Kommentare (0) Keine Kommentare gefunden!