Naturwissenschaft und Religion in der Schule
Leitartikel von Martin Rothgangel
Empirische Einblicke und bildungstheoretische Konsequenzen
Das Thema „Naturwissenschaft und Religion“ ist ausgesprochen komplex und vielfältig. So beschäftigen immer wieder bestimmte Facetten dieses Themas die öffentliche Aufmerksamkeit: Spätestens seit den 1980er Jahren die Umwelt- und Schöpfungsproblematik, in den 1990er Jahren trat zunehmend die bioethische Diskussion in das Rampenlicht, seit Beginn des neuen Jahrtausends widmen sich zahlreiche populärwissenschaftliche Fachzeitschriften dem Phänomen „Gott und Gehirnforschung“ und gegenwärtig bestimmt unvermutet die Kreationismus- bzw. „Intelligent Design“-Diskussion oder der öffentlichkeitswirksame Atheismus von Richard Dawkins die Schlagzeilen.
Richtet man vor diesem Hintergrund den Blick auf die religionspädagogische Diskussion, dann lässt sich feststellen, dass zu den genannten Themen durchaus entsprechende Veröffentlichungen in theoretischer und praktischer Hinsicht existieren.[1] Dennoch sind ungeachtet einer verstärkten religionspädagogischen Publikationstätigkeit nach wie vor Defizite festzustellen. Beispielhaft zeigt dies die Publikation von Guido Hunze (2007, 17-26) zur Schöpfungsthematik.[2]
1. Die Behandlung von „Schöpfung“ in Schulbüchern [3]
Hunze untersucht auf der Grundlage der Analyse von drei exemplarisch ausgewählten Schulbuchreihen (1. Trutwin: „Zeit der Freude“ – „Wege des Glaubens“ – Zeichen der Hoffnung“; 2. Hilger/Reil: „Reli“; 3. Koretzki/Tammeus: „Religion entdecken – verstehen – gestalten“), wie das Thema „Schöpfung“ im Religionsunterricht behandelt wird. In methodischer Hinsicht nimmt er zum einen quantitativ in den Blick, wie häufig Begriffe mit dem Wortstamm ‚schöpf’ und ‚schaff’ vorkommen, wobei er zugleich reflektiert, in welchem Kontext sie verwendet werden. „Auf diese Weise ergibt sich ein Längsschnitteindruck, der erste Hinweise darauf gibt, welches Schöpfungsverständnis dem Unterrichtswerk eigen ist und ob bzw. inwiefern sich dieses als theologisch grundlegend erweist.“ (Hunze 2007, 34)
Zum anderen ermittelt er einen Querschnittseindruck, indem er diejenigen Kapitel von Unterrichtswerken analysiert, in denen explizit das Thema Schöpfung behandelt wird. Als Resümee seiner Schulbuchanalyse markiert Hunze (2007, 67-69) folgende fünf Problemfelder:
(1) Nur in einem der drei untersuchten Unterrichtswerke stellt Schöpfung einen wichtigen bzw. zentralen Bezugspunkt dar.
(2) Fast durchgängig wird der Schöpfungsbegriff ganz selbstverständlich verwendet, ohne den Bedeutungsgehalt des Begriffs näher zu klären.
(3) Wird Schöpfung in ethischer Hinsicht thematisiert, dann können Defizite in der theologischen Argumentation dazu führen, dass der Schöpfungsbegriff synonym mit „Umwelt“ bzw. „Natur“ verwendet wird.
(4) Werden biblische Weltbilder in eine Reihe mit naturwissenschaftlichen Weltbildern gestellt, dann kann sich der Eindruck einstellen, dass die biblischen Weltbilder von den naturwissenschaftlichen überholt worden sind.
(5) Die Frage nach der Schöpfung wird primär biblisch-theologisch, weniger systematisch-theologisch reflektiert.
Hier liegt zweifellos eine wichtige Pilotstudie vor. Im Sinne einer kumulativen Forschungsarbeit könnte diese Untersuchung unschwer auf weitere Unterrichtswerke sowie auch auf Lehrpläne ausgeweitet werden. Da die methodische Vorgehensweise von Studierenden gut nachvollzogen und das Untersuchungsfeld der Schulbücher sinnvoll eingegrenzt werden kann, könnten Teilanalysen zu dieser Thematik auch in Form von Bachelor- und Masterarbeiten im Rahmen des Studiums geleistet werden. Interessant wäre der Versuch, ob nicht auch SchülerInnen der Sekundarstufe II derartige Analysen in Form von Abschlussarbeiten leisten können. Dies wäre zugleich ein Beitrag, um den kritischen Umgang von SchülerInnen mit eigenen Schulbüchern zu fördern.
Nur im Kontext religionspädagogischer Forschung leistbar wäre es, auf der Grundlage der methodischen Vorgehensweise der Qualitativen Inhaltsanalyse von P. Mayring ein auf das Themenfeld „Naturwissenschaft und Religion“ entsprechendes Kategoriensystem zu generieren und damit Unterrichtswerke zu analysieren. Zweifellos besteht in dieser Hinsicht noch erheblicher religionspädagogischer Forschungsbedarf.
2. Empirische Erhebungen bei SchülerInnen
Gerade die fachwissenschaftliche und wissenschaftstheoretische Komplexität des Themas „Naturwissenschaft und Religion“ sowie die Vielzahl der oben angesprochenen gesellschaftlich relevanten Teilaspekte wie z.B. Bioethik und Kreationismus kann dazu führen, dass die Relevanz und Kompatibilität für die SchülerInnen unzureichend berücksichtigt wird. Der Verfasser selbst besaß zunächst die Absicht, auf der Grundlage der Dissertation von M. Worthing (2005) zum Thema „Contemporary Physics and the Christian Doctrine of God“ eine entsprechende religionspädagogische Studie zur Relevanz der Modernen Physik für den Religionsunterricht zu verfassen. Nach der Kenntnisnahme und Reanalyse von empirischen Studien, welche den Bereich „Naturwissenschaft und Religion“ direkt oder indirekt erfassen, wurde jedoch deutlich, dass die Relevanz der modernen Physik für den Religionsunterricht nur sehr eingeschränkt besteht. Vielmehr sind folgende zwei Themenkreise für SchülerInnen entscheidend und bildungsrelevant: Erstens das Thema „Beweis“ sowie zweitens das Verhältnis von biblischen Schöpfungserzählungen und naturwissenschaftlichen Welt- und Lebensentstehungstheorien (Rothgangel 1999, 94).
Bemerkenswert ist, dass dieses Ergebnis bereits durch die Reanalyse von Items hervortrat, die gar nicht spezifisch zum Thema „Naturwissenschaft und Religion“, sondern zur Gottesthematik formuliert worden waren. Als grundlegende Kategorien von SchülerInnen hinsichtlich des Verhältnisses von Naturwissenschaft und Theologie kristallisierten sich folgende drei Typen heraus, die jeweils mit einem Textbeispiel konkretisiert werden (ausführlich dazu Rothgangel 2004):
(1) Naturwissenschaft widerlegt Gott: “Gott war mal da und es gibt ihn nicht mehr. Wenn man logisch denkt, sieht man das auch ein. Die Menschen wären vom Gott entstanden. Das ist doch Blödsinn. Man hat doch bewiesen, daß die Menschen vom Affen abstammen ... Wenn es Gott gibt, dann soll er doch kommen und uns helfen. Soll er doch die Kriege, die auf der Erde sind, abschaffen, dann soll er doch kommen und allen Menschen beweisen, daß er da ist. ... Wenn er was beweist, dann erst glaube ich an ihn.”
(2) Naturwissenschaft und Glaubenskonflikt: “Die Wissenschaft läßt ebenfalls immer mehr Menschen an der Existenz Gottes zweifeln nach dem Motto 'Was ich nicht sehen kann glaube ich nicht'. ... Gott ist im Prinzip alles und nichts, ich selbst habe keine genauen Vorstellungen. Ich glaube an Gott, weil ich etwas brauche an das ich glauben kann und vielleicht auch, weil ich so erzogen wurde.”
(3) Vermittlungsstrategien von Naturwissenschaft und Gottesglaube: “Ich bin nicht der Ansicht, daß Erkenntnisse der modernen Naturwissenschaften den Glauben an Gott widerlegen können, weil man das, was man glaubt, nicht mit realen Dingen vergleichen kann. Keiner wird behaupten, die Welt wurde in 7 Tagen erschaffen. Die Schöpfungsgeschichte ist wohl eher sinnbildlich gemeint. Man kann nicht mit Naturwissenschaft Zufälle messen... was, das man nicht sieht. Man kann keine Liebe seh'n und sie ist da, wir werden von ihr beeinflusst, sie lässt uns Dinge tun, aber keiner kann's wissenschaftlich belegen. Man kann die Pulse messen etc. aber nicht das Gefühl, also kann man die Existenz Gottes nicht nachweisen.”
In didaktischer Hinsicht können diese Typen der Verhältnisbestimmung als eine Heuristik für Lehrkräfte dienen, um davon ausgehend Lehr-Lernprozesse zu planen. Allerdings ist es ratsam, zu Beginn von Unterrichtseinheiten entsprechende Umfragen durchzuführen, um die Lernausgangslage der jeweiligen Lerngruppe differenziert und spezifisch erfassen zu können.
Als hilfreich zum Verständnis der Alltagstheorien hinsichtlich des Verhältnisses von Naturwissenschaft und Theologie erweisen sich des Weiteren die Studien von K.H. Reich u.a. zum Denken in Komplementarität.[4] Ein bemerkenswertes Ergebnis der Studien zum komplementären Denken ist u.a., dass SchülerInnen gerade im Bereich „Schöpfung und naturwissenschaftliche Welt- und Lebensentstehungstheorien“ eine niedrigere Performanz des komplementären Denkens aufweisen als in anderen Domänen (Rothgangel 1999, 50f.). Allein dieser Befund lässt darauf schließen, dass sich diese Thematik nicht einfach „en passent“ im Religionsunterricht erledigen lässt, sondern im Sinne eines Spiralcurriculums als ein kumulativer Lernprozess zu gestalten ist.
Dies unterstreicht auch die Befragung von über 8000 SchülerInnen von A. Feige und C. Gennerich (2008), aus der zwei Ergebnisse hervorgehoben werden sollen: In keinem anderen Bereich ihrer empirischen Befragung stellen sie derart hohe Standardabweichungen hinsichtlich des Mittelwertes fest als in ihren Items zu Vorstellungen über Weltentstehung. „Das ist ein Indiz für die Strittigkeit unter den befragten Jugendlichen/Jungen Erwachsenen.“ (102) Des weiteren führt die Faktorenanalyse zu dem Resultat, dass die Semantik von „Zufall“ und „Urknall“ unvereinbar zu sein scheint mit der von „Gottes Schöpfung“ (105).
Insbesondere besteht im Blick auf die gegenwärtige Aktualität von Kreationismus bzw. Intelligent Design einerseits sowie der deutlichen Hinweise auf eine beachtliche Verbreitung szientistischer Einstellungen andererseits das Desiderat einer empirischen Studie, welche die Verbreitung kreationistischer und szientistischer Einstellungen im bundesdeutschen Kontext erfasst.[5] Entsprechende Vorarbeiten finden sich in den Items von Fulljames und Francis, welche u.a. in Erhebungen in Kenia und Schottland verwendet wurden (Fulljames/Francis 1988; Gibson 1989). Die Studie von Britta Klose (2014) dokumentiert jedoch, dass es relativ anspruchsvoll ist, selbst auf der Grundlage eines bestehenden Fragebogens valide und reliable Items zu formulieren. Des weiteren treten Probleme der Items von Fulljames und Francis hervor, die z.B. darauf beruhen, dass schon allein die Redeweise von „true christians“, „wahren Christen“ zumindest im bundesdeutschen Kontext problematisch zur Erfassung kreationistischer Einstellungen ist.

3. Empirische Erhebungen bei ReligionslehrerInnen
Wie wichtig empirische Analysen zu diesem Themenbereich auch bei ReligionslehrerInnen sind, vermag eine Pilotstudie des Verfassers zu zeigen. In diesem Rahmen führte er ein schriftliches Interview mit einer erfahrenen Lehrkraft durch, welche eine dreistündige Einheit zu Gen 1 plante. Dabei antwortete die Lehrperson auf die Frage, welche Schülereinstellungen und -vorstellungen sie zu Gen 1 erwartet, indem sie die folgenden fünf Gruppen in ihrer Klasse unterschied:
(1) Kirchlich, sozialisierte und engagierte SchülerInnen
(2) Christlich sozialisierte, aber nicht engagierte SchülerInnen
(3) Indifferent sozialisierte SchülerInnen, die aber interessiert und offen sind
(4) Kirchenkritisch sozialisierte SchülerInnen, die auch selber kirchenkritisch sind
(5) SchülerInnen, über die mir nichts bekannt ist.
Eine nähere Analyse dieser ersten Rückmeldung zeigt, dass wesentliche Parameter der Lehrerdiagnose zum einen in der Wahrnehmung der religiösen Sozialisation der SchülerInnen durch deren Elternhaus besteht (kirchlich – christlich – indifferent – kirchenkritisch), zum anderen in dem Verhalten bzw. der Einstellung der SchülerInnen (engagiert – nicht engagiert; offen, interessiert; kirchenkritisch). Die Lehrkraft nimmt demnach die SchülerInnenbetrachtung durch die Faktoren elterliche Sozialisation sowie Schülerverhalten bzw. -einstellung vor. Bei alledem verdient jedoch beachtet zu werden, dass die Lehrkraft ungeachtet der konkreten Rückfrage keinen spezifischen Bezug zur vorliegenden Thematik Gen 1 vornahm, vielmehr pauschal den Ausgangszustand der Lernenden benannte. Dies führte zu einer abermaligen Rückfrage nach den Schülervorwissen und –einstellungen bzgl. Gen 1, welche zu folgendem Ergebnis führte:
(1) Die Lehrkraft schätzt aus der Perspektive der oben genannten fünf Gruppen das Vorwissen bzw. die Voreinstellung der SchülerInnen ein. Eine offene Frage lautet in diesem Zusammenhang, ob diese Perspektive angemessen ist oder den Blick auf eine angemessenere Wahrnehmung beeinträchtigt?
(2) Die Wahrnehmung des Vorwissens/der Voreinstellung erfolgt in Verbindung mit didaktischen Möglichkeiten (z.B. „selber klären“, „behutsam nahe bringen“). Dem schließt sich wiederum die Frage an, ob diese zu früh in den Blick kommen, d.h. verstellt der „Handlungsdruck“ weitere Wahrnehmungen oder eröffnet gerade der Handlungsdruck ganz spezifische Wahrnehmungen?
(3) Die „inhaltliche Hauptbrille“ besteht darin, ob SchülerInnen ein biblizistisches Welterklärungsmodell besitzen oder nicht bzw. ob eine Kenntnis alternativer Welterklärungsmodelle vorhanden ist, welche die Aporie von biblizistischen Welterklärungsmodellen überwindet.
Resümierend zeigt sich, wie Lehrkräfte gleichsam unterrichtspraktische Empiriker sind: Auch sie besitzen ganz bestimmte Beobachtungskategorien, wobei diese hinsichtlich ihrer „Fruchtbarkeit“, ihren Grenzen und Stärken noch näher zu erforschen sind.
Einen wichtigen Beitrag speziell im Blick auf die Diagnosekompetenz von Lehrkräften hat diesbezüglich Britta Klose (2014) geleistet. Ein wesentliches Ergebnis ihrer Studie ist, dass die Diagnosekompetenz domänenspezifisch ist, d.h. dass Lehrkräfte ihre SchülerInnen je nach Themenbereich unterschiedlich gut einschätzen können (ebd., 213). Dies impliziert, dass themenspezifische Fortbildungen gerade zu einem komplexen Themenbereich wie „Naturwissenschaft und Religion“ unabdingbar sind.
4. Bildungstheoretische Konsequenzen[6]
Generell zeigen die empirischen Analysen, dass die Schöpfungsthematik und das damit verbundene Verhältnis von Gott und Naturwissenschaft ein wesentliches religionspädagogisches Thema darstellt. Gegenwärtig wird es zwar im Religionsunterricht behandelt, aber doch keineswegs seiner Bedeutung entsprechend wahrgenommen. Diese Thematik stellt eine zentrale Herausforderung für religionspädagogische Bildungsbemühungen dar, wenn man den Einbruch des Gottesglaubens im Jugendalter ernst nimmt. Das Verhältnis von Gottesbild und Naturwissenschaft sollte im Rahmen eines Spiralcurriculums zumindest jedes zweite Schuljahr behandelt werden. Das mag übertrieben klingen: Jedoch handelt es sich bei dieser Thematik um ein Schlüsselproblem des Religionsunterrichts, das sich nicht en passant lösen lässt. Vielmehr bedarf es einer religionspädagogischen Biographiebegleitung für die Kindheit und das Jugendalter:

a) Kindheit
Unvermeidlich stellen sich bei Kindern kontrovers diskutierte Fragen: Besitzen die Welt- und Gottesbilder von Kindern ihre eigene Berechtigung oder sind sie als ein notwendiges Übel hinzunehmen? Müssen diese kindlichen Sichtweisen akzeptiert oder bereits vom frühen Kindesalter an korrigiert werden? Gegenwärtig kristallisiert sich in dieser Hinsicht ein religionspädagogische Kompromiss heraus: „verweilen lassen und fördern“. Das archaische Welt- und anthropomorphe Gottesbild von Kindern besitzt seine eigene Berechtigung. Kinder besitzen ein Recht darauf, in ihrem jeweiligen Stadium verweilen und ihre archaischen, mythisch-wortwörtlichen, artifzialistischen und anthropomorphen Denkmöglichkeiten entfalten zu dürfen. Die biblischen Geschichten zur Welt- und Lebensentstehung und das damit verbundene Welt- und Gottesbild entsprechen diesem Denken. Es ist grundverkehrt, aufgrund eines veränderten naturwissenschaftlichen Weltbildes sowie aufgrund historisch-kritischer Erkenntnisse den Kindern die biblischen Schöpfungserzählungen vorzuenthalten (vgl. Fetz/Reich/Valentin 2001, 357). Für das artifizialistische Schöpfungsverständnis von Kindern findet sich gerade in Gen 1,1ff der angemessene Ausdruck, dass Gott der heilschaffende Schöpfer der Welt ist. Kinder können von den Erzählungen in Gen 1,1ff gefesselt werden. Sie entspricht ihrer Welt, ihrer Gedankenwelt. Daraus folgt als ein erstes Bildungsziel:
(1) Die biblischen Schöpfungserzählungen kennenlernen und zum Ausdruck bringen.
Umgekehrt werden Kinder in einer naturwissenschaftlich geprägten Lebenswelt stets Impulse bekommen, dass z.B. die Erde rund ist. Kognitive Dissonanzen sind auf die Dauer unausweichlich. Das heißt aber auch: Nicht nur verweilen lassen, sondern auch – in aller Behutsamkeit – fördern. Die zentrale Aufgabe für den Religionsunterricht heißt dann: Wie kann ich die sich entwickelnden Weltbilder der Kinder religionspädagogisch so begleiten, dass die theologisch unaufgebbare Aussage von Gott als Schöpfer mit dem jeweiligen Weltbild kompatibel ist. In diesem Sinne empfehlen sich m.E. die nachstehenden Bildungsziele, die im Anschluss an W. Ritter (1999, 333) formuliert sind:
(2) „Gottes gute Schöpfung schmecken, sehen, spüren und erfahren“;
(3) „Staunen und Freude über und an der guten Schöpfung Gottes in biblischen Texten (v.a. Psalmen) und bei uns empfinden“;
(4) „von Lob und Dank für Gottes gute Schöpfung hören und dies selber ausdrücken und gestalten“;
(5) „vom Leid in der Schöpfung hören und die Bedrohung der Schöpfung wahrnehmen“;
(6) „vom ‚Bebauen und Bewahren’ der Schöpfung hören und eine Aktion mitgestalten“.
b) Jugendalter
Neue religionspädagogische Herausforderungen stellen sich bei Jugendlichen. Provozierend sei folgende These aufgestellt: Auch das kritisch-hypothetische Denken Jugendlicher besitzt wie das mythisch-wortwörtliche Denken von Kindern seine eigene Würde, seine eigene Dignität. V.a. die folgenden zwei Themenkreise sind aufgrund ihres exemplarischen Charakters zentral: zum einen die Welt- und Lebensentstehung, zum anderen das Thema „Grenzen und Tragweite naturwissenschaftlicher Theorien“. Diese beiden Themen wirken sich für viele Jugendliche entscheidend und folgenreich auf ihr Gottesbild aus.
Gerade im Blick auf das kritische Bewusstsein Jugendlicher besitzt die historisch-kritische Methode eine besondere Chance. Mit allem Nachdruck sind aus diesem Grund die zwei biblischen Schöpfungserzählungen historisch-kritisch auszulegen. Hier zeigt sich zum einen, dass die biblischen Schöpfungsgeschichten „naturwissenschaftliche“ Weltbilder früherer Zeiten enthalten. Auf diesem Hintergrund wird zum Ausdruck gebracht, dass Gott der Schöpfer des Himmels und der Erde ist. Für Jugendliche ist es nachvollziehbar, dass das Bekenntnis von Gott als Schöpfer vor zwei- bis dreitausend Jahren nicht mit der Urknall- bzw. Evolutionstheorie erläutert werden konnte. Zum anderen ist zu betonen, dass die biblischen Schöpfungserzählungen im Kontext der Heilsgeschichte zu verstehen sind. Des Weiteren ist die kritische Haltung Jugendlicher auch im Blick auf die Grenzen und Tragweite naturwissenschaftlicher Theorien zu schärfen. Wie gültig sind Sinneserfahrungen? Kann eine naturwissenschaftliche Theorie überhaupt verifiziert werden? Was ist die Tragweite, was sind die Grenzen naturwissenschaftlicher Theorien? Bestimmte Texte von K. Popper oder anderen Wissenschaftstheoretikern können – wie Erfahrungen aus dem Philosophieunterricht zeigen – durchaus bereits ab der 9. Klasse behandelt werden.
Für Jugendliche legen sich folgende Bildungsziele nahe:
(1) Die jeweilige Eigenart der Schöpfungserzählungen nach Gen 1-2,4a und Gen 2,4bff form- und traditionsgeschichtlich darlegen können, ihre Unterschiedenheit von einem historischen Tatsachenbericht verstehen und ihre Bezugnahme auf naturkundliches Wissen der damaligen Zeit sowie ihre Auseinandersetzung mit fremdreligiösen Vorstellungen („Sterne als Leuchten“) erkennen;
(2) die Unterschiedenheit der Weltzugänge von Naturwissenschaft und Theologie verstehen (vgl. besonders Unabhängigkeitsmodell nach K. Barth) und auf diesem Hintergrund sowohl kreationistische wie szientistische Einstellungen kritisieren können;
(3) Vereinbarungsstrategien von Naturwissenschaft und Theologie hinsichtlich des Verhältnisses von theologischer Schöpfungslehre und naturwissenschaftlichen Welt- und Lebensentstehungstheorien in ihren Stärken und Grenzen darlegen können und verstehen;
(4) „Schöpfungspsalmen als Ausdrucksmöglichkeiten des Staunens und der Freude an Gottes Schöpfung erkennen“ (Ritter 1999, 334) und gestalten;
(5) „die Folgen von Geschöpflichkeit für Lebensverständnis und Lebensgestaltung erkunden und bedenken (Mann und Frau; Schöpfungsauftrag; Ebenbild Gottes)“ (ebd.);
(6) die Gefährdung der Schöpfung wahrnehmen und „ein Projekt zur ‚Bewahrung’ der Schöpfung vorbereiten und durchführen“ (ebd.) können.
Insgesamt zeigt sich: Die verschiedenen Vorstellungen von Kindern und Jugendlichen sowie die diversen gesellschaftlichen Problemstellungen zum Themenbereich „Naturwissenschaft und Religion“ ziehen jeweils ganz unterschiedliche bildungstheoretische Herausforderungen nach sich, die erhebliche Anforderungen an ReligionslehrerInnen stellen. Wünschenswert wäre in diesem Zusammenhang eine fächerübergreifende Zusammenarbeit insbesondere mit dem Sachunterricht (bzw. vergleichbaren Fächern) in der Primarstufe sowie dem Biologie- und Physikunterricht in der Sekundarstufe I und II.
Martin Rothgangel
Veröffentlicht im März 2014
Prof. Dr. Martin Rothgangel, geboren 1962, studierte Lehramt Hauptschule und ev. Theologie in Erlangen inkl. eines Gastsemesters kath. Theologie in Regensburg, wo er 1990-1998 als Wiss. Mitarbeiter am Lehrstuhl für Evangelische Theologie und Religionspädagogik tätig war. 1993-1998 war er zudem nebenamtlich Religionslehrer an der Wirtschaftsschule in Regensburg. 1994 erfolgte die Promotion zum Dr. theol. an der Univ. München, 1996 die Habilitation zum Dr. phil. habil. an der Univ. Regensburg. 1998-2002 war er Professor für Religionspädagogik/Evangelische Theologie an der PH Weingarten, 2002-2010 Professor für Praktische Theologie/Religionspädagogik an der Univ. Göttingen, seit März 2010 ist er am Institut für Religionspädagogik an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien tätig.
Sie lesen lieber aus einem Buch? Sie finden diesen Artikel auch in unserem Buch zu dieser Webseite, "Wissenschaft und die Frage nach Gott" (Bonn 3. Aufl. 2018). 18 Beiträge von renommierten Autorinnen und Autoren, darunter die Erzbischöfin von Schweden, führen in den Dialog mit der Wissenschaft angesichts der Gottesfrage ein.
Anmerkungen
[1] Vgl. dazu exemplarisch die Monographien von Angel 1988, Rothgangel 1999, Fetz/Reich/Valentin 2001; Hunze 2007; Höger 2008; Fuchs 2009.
[2] Der Diskussionstand Ende der 1980er Jahre zur Analyse von Religionsbüchern findet sich bei Dieterich 1990.
[3] Wesentliche Passagen der ersten drei Abschnitte stammen aus Rothgangel 2009.
[4] Vgl. Fetz/Reich/Valentin 2001 sowie die dort enthaltenen Hinweise auf frühere Publikationen insbesondere von F. Oser und K.H. Reich.
[5] Eine derartige empirische Studie wird gegenwärtig in Zusammenarbeit mit dem Institut für Biologiedidaktik der Universität Münster (Prof. Dr. Marcus Hammann) angefertigt.
[6] Die folgenden Ausführungen finden sich in M. Rothgangel 2012, bes. 316-319.
Literatur
Angel, H.-F. (1988), Naturwissenschaft und Technik im Religionsunterricht (RSTh 37), Frankfurt/M.
Dieterich, V.-J. (1990), Naturwissenschaftlich-technische Welt und Natur im Religionsunterricht. Eine Untersuchung von Materialien zum Religionsunterricht in der Weimarer Republik und in der Bundesrepublik Deutschland (1918-1985), 2 Bde. Frankfurt/M.
Feige A. / Gennerich, C. (2008), Lebensorientierungen Jugendlicher. Alltagsethik, Moral und Religion in der Wahrnehmung von Berufsschülerinnen und -schülern in Deutschland. Eine Umfrage unter 8.000 Christen, Nicht-Christen und Muslimen, Münster u.a.
Fetz, R. L. / Reich, K. H. / Valentin, P. (2001), Weltbildentwicklung und Schöpfungsverständnis. Eine strukturgenetische Untersuchung bei Kindern und Jugendlichen, Stuttgart / Berlin / Köln.
Fuchs, M. E. (2009), „Wer legt denn fest, was ‚normal’ ist?“ Bioethische Urteilsbildung im Religionsunterricht. Theoretische Reflexion – Empirische Rekonstruktion (Arbeiten zur Religionspädagogik 43), Göttingen.
Fulljames, P. / Francis, L. J. (1988), The Influence of Creationism and Scientism on Attitudes towards Christianity among Kenyan Secondary School Students, in: Educational Studies 14, 77-96.
Gibson, H. M. (1989), Attitudes to Religion and Science Among Schoolchildren Aged 11-16 Years in a Scottish City, in JET 2, H. 1, 5-26.
Höger, C. (2008): Abschied vom Schöpfergott? Welterklärungen von Abiturientinnen und Abiturienten in qualitativ-empirisch religionspädagogischer Analyse. Berlin / Wien.
Hunze, G. (2007), Die Entdeckung der Welt als Schöpfung. Religiöses Lernen in naturwis- senschaftlich geprägten Lebenswelten (Praktische Theologie heute 84), Stuttgart.
Klose, B. (2014), Diagnostische Wahrnehmungskompetenzen von ReligionslehrerInnen (Religionspädagogik innovativ 6), Stuttgart.
Ritter, W. (1999), Schöpfung/Leben, in: Lachmann, R. / Adam, G. / Ritter, W. (Hrsg.): Theologische Schlüsselbegriffe. Biblisch – systematisch – didaktisch (TLL 1), Göttingen, 320-336.
Rothgangel, M. (1999), Naturwissenschaft und Theologie. Ein umstrittenes Verhältnis im Horizont religionspädagogischer Überlegungen (Arbeiten zur Religionspädagogik 16), Göttingen.
Rothgangel, M. (2004), Gottes- oder Affenkind? Bibel und Naturwissenschaft bei SchülerInnen, in: Feldmeier, R.; Spieckermann, H. (Hrsg.), Die Bibel. Entstehung - Botschaft – Wirkung, Göttingen, 117-131.
Rothgangel, M. (2009), „Naturwissenschaft und Theologie“ aus der Perspektive empirischer Unterrichtsforschung, in: Theo-Web. Zeitschrift für Religionspädagogik 8, H. 1, 68-74.
Rothgangel, M. (2012), Schöpfung – Praktisch-theologische Herausforderungen und bildungstheoretische Konsequenzen, in: K. Schmid (Hg.), Schöpfung (Themen der Theologie 4), Tübingen, 295-323.
Worthing, M. W. (1995), Contemporary Physics and the Christian Doctrine of God, Minneapolis.
Bildnachweis
Tafelbild #62388461 © Serg Nvns - Fotolia.com
Schüler #58569122 © contrastwerkstatt - Fotolia.com
Lehrer #50701566 © Woodapple - Fotolia.com
Schulkinder #40651339 © contrastwerkstatt - Fotolia.com
Jugendliche Schüler #52126992 © Monkey Business - Fotolia.com
Diesen Beitrag fand ich...
Naturwissenschaft und Religion in der Schule
Was halten Sie von der Analyse und den Thesen von Martin Rothgangel? Entspricht das auch Ihren Erfahrungen in der Schule?
Für Martin Rothgangel zeigt sich, dass die verschiedenen Vorstellungen von Kindern und Jugendlichen sowie die diversen gesellschaftlichen Problemstellungen zum Themenbereich „Naturwissenschaft und Religion“ jeweils ganz unterschiedliche bildungstheoretische Herausforderungen nach sich ziehen, die erhebliche Anforderungen an ReligionslehrerInnen stellen. Wünschenswert wäre für ihn in diesem Zusammenhang eine fächerübergreifende Zusammenarbeit insbesondere mit dem Sachunterricht (bzw. vergleichbaren Fächern) in der Primarstufe sowie dem Biologie- und Physikunterricht in der Sekundarstufe I und II. Wie stehen Sie dazu?
An erster Stelle haben wir Prof. Dr. Astrid Dinter um eine Stellungnahme gebeten.

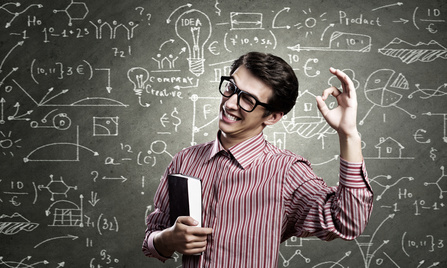


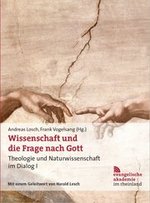

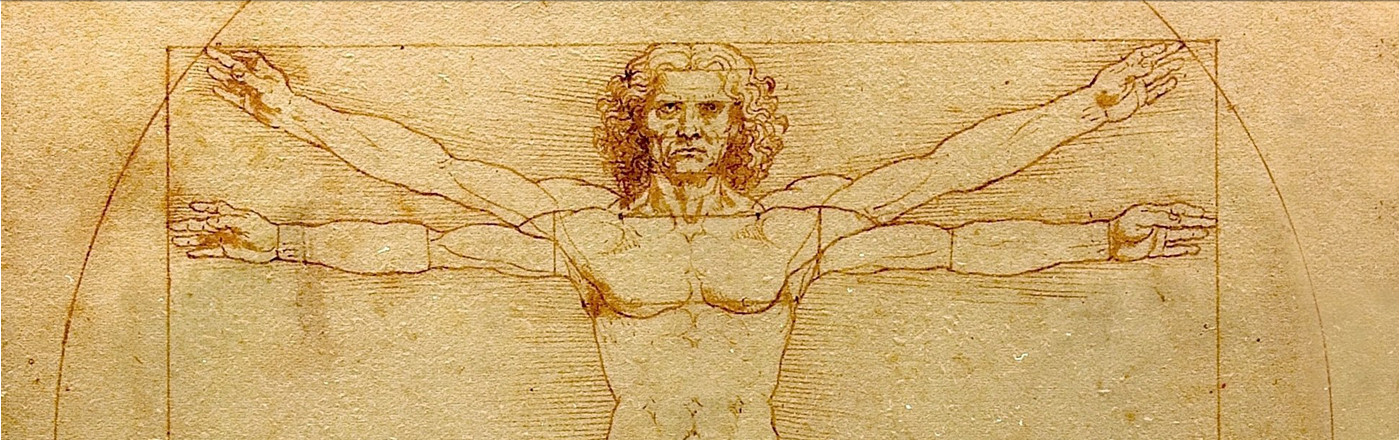





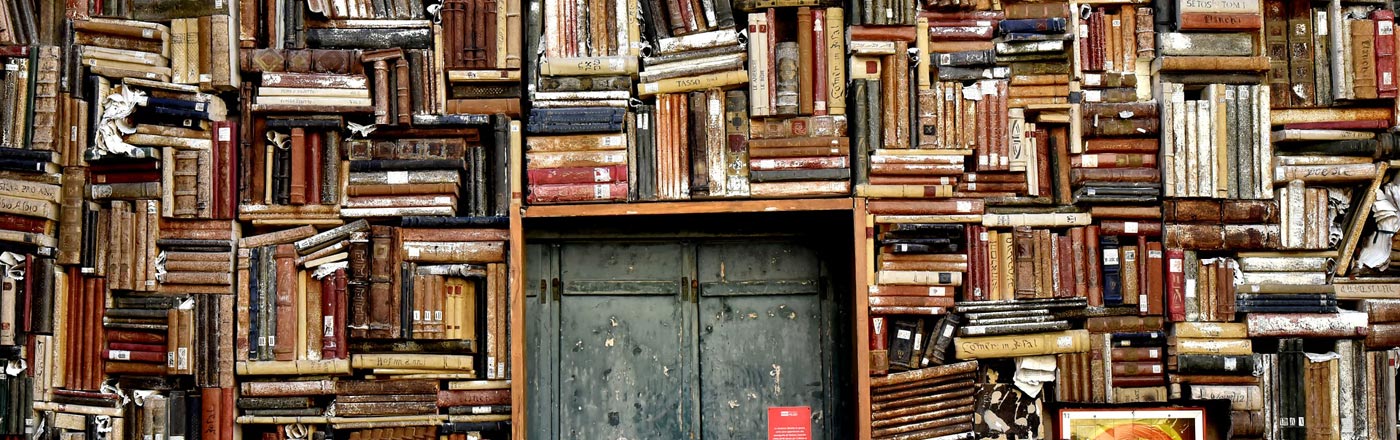


Kommentare (1)-

Antworten
Der Artikel von Martin Rothgangel informiert umfassend über die deutschsprachige Situation der Thematik „Naturwissenschaft und Religion“ in der Schule. Martin Rothgangel stellt zunächst die Publikation von Guido Hunze (2007) zum Schöpfungsbegriff vor, deren methodisches Vorgehen auch auf weitere Unterrichtswerke sowie auf Lehrpläne hin ausgeweitet werden könnte. Ob ein derartiges Vorgehen von Schülern und Schülerinnen der Sekundarstufe II zu leisten ist, bleibt zu diskutieren. Martin Rothgangel arbeitet zwei Themenfelder heraus, die für Schüler und Schülerinnen hinsichtlich der Thematik „Naturwissenschaft und Religion“ entscheidend sind: Das Thema „Beweis“ sowie das Verhältnis von biblischen Schöpfungserzählungen und naturwissenschaftlichen Welt- und Lebensentstehungstheorien. Er zeigt die Relevanz von K.H. Reichs Ansatz des komplementären Denkens für das genannte Themenfeld auf, dessen Einübung „im Sinne eines Spiralcurriculums als ein kumulativer Lernprozess“ gestaltet werden sollte. Martin Rothgangel betont die Notwendigkeit einer empirischen Studie zur Verbreitung „kreationistischer und szientistischer Einstellungen im bundesdeutschen Kontext“. Ob hier die Items bestehender Studien aus dem angelsächsichen Raum von Fulljames und Francis (1988) zu übernehmen sind, reflektiert Martin Rothgangel kritisch. Hier ist eine Weiterentwicklung der Items anzuraten.
Prof. Dr. Astrid Dinter
am 29.05.2014Martin Rothgangel stellt die Bedeutung des Themenbereichs für den schulischen Unterricht heraus und zeigt auf, dass es sich um ein Schlüsselproblem handelt, das einer entsprechend umfangreichen Unterweisung bedarf. Diese bildet eine religionspädagogische Biographiebegleitung für die Kindheit bzw. das Jugendalter. Kinder sollten nach Martin Rothgangel trotz eines mythisch-wörtlichen Schöpfungsverständnisses Gen 1 kennenlernen. Er formuliert jedoch im Anschluss an W. Ritter (1999) Bildungsziele, die nicht zwingend durch eine Auseinandersetzung mit Gen 1 erreicht werden müssen. So wären die Psalmen geeignet die Bildungsziele zu erreichen, ohne in die komplexen Debatten um Gen 1 einzusteigen. Für das Jugendalter sollen für Martin Rothgangel die Themen „Welt- und Lebensentsstehung“ bzw. „Grenzen und Tragweite naturwissenschaftlicher Theorien“ im Mittelpunkt stehen: Es geht darum, die Verschiedenheit von Naturwissenschaft und Theologie zu verstehen. Einer fächerübergreifenden Zusammenarbeit kommt dabei besondere Bedeutung zu. Martin Rothgangel rät zudem zu themenspezifischen Fortbildungen für den Bereich „Naturwissenschaft und Religion“ für die Lehrer und Lehrerinnen.
Den beschriebenen Forschungsdesideraten bzw. den entsprechenden pädagogischen Schlussfolgerungen Martin Rothgangels ist nachdrücklich zuzustimmen. Hilfreich kann es dabei sein, die angelsächsische Perspektive - trotz ihres unterschiedlichen pädagogischen Settings – noch stärker in den Blick zu nehmen. Hier ist z.B. das „Science and Religion in Schools“-Projekt zu nennen. In jedem Fall ist Martin Rothgangels Artikel „Naturwissenschaft und Religion in der Schule“ zur Lektüre zu empfehlen.