
Musste der Mensch sein?
Leitartikel von Hansjörg Hemminger
Über das anthropische Prinzip in der Evolution
Das anthropische Prinzip in einer „schwachen“ Form besagt, dass das von uns beobachtbare Universum so beschaffen sein muss, dass es Beobachter mit umfasst, die imstande sind, sich eine Vorstellung des Universums (oder der Abläufe in ihm) zu machen. Die biologische Form des Prinzips lautet, dass die Evolution so abgelaufen sein muss, dass ein intelligentes Wesen dabei entstand, das imstande ist, den Prozess der Evolution zu verstehen. Das klingt trivial, da wir Menschen erstens da sind, zweitens zum Universum und zur belebten Natur gehören, und drittens über Verstehensprozesse mit der natürlichen Welt interagieren. Was ist, muss auch möglich sein, also warum daraus ein Prinzip machen?
Wissenschaftstheoretisch ist es allerdings nicht ganz trivial, dass das Subjekt des Forschens Teil des erforschten Phänomens ist. Und es ist nicht trivial, dass die Existenz dieses Subjekts physikalisch eine Feinabstimmung der kosmischen Variablen erfordert, ohne die Leben in der uns bekannten Form nicht möglich wäre. Der Energiezustand des Elektrons, die schwache Wechselwirkung und andere unabhängige Konstanten dürften nicht anders sein, sonst ergäbe sich ein Universum ohne Lebewesen und damit ohne den Menschen. Aber was beweist diese unwahrscheinlich anmutende Feinabstimmung?
Naturwissenschaftlich nichts, denn ein Plausibilitätsargument ist davon abhängig, dass man die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses beziffern kann. Dazu muss man das „Set“ aller möglichen Ereignisse kennen oder abschätzen. Quantitative Aussagen über die physikalische Möglichkeit oder Unmöglichkeit anderer Universen mit anderen Naturkonstanten sind auf dem derzeitigen Stand der Physik jedoch nicht verfügbar. Dennoch gab und gibt es Versuche, aus dem verblüffenden physikalischen Sachverhalt ein „starkes“ anthropisches Prinzip abzuleiten, indem man physikalische, philosophische und religiöse Gründe für ihn anführt. Und in der Tat weckt die prekäre physikalische Grundlage des Lebens erst einmal Staunen, sie spricht unseren ästhetischen Sinn an, vielleicht auch die Sehnsucht nach einer visionären Gesamtschau der Welt. Aber welche Schau ergibt sich aus der ästhetischen Anmutung des „starken“ anthropischen Prinzips? Die Deutungen reichen von göttlicher Vorsehung über eine innere Zielgerichtetheit des Kosmos (immanente Teleologie) bis zur Spekulation über ein Multiversum, in dem alle möglichen Kosmologien realisiert sind. Anders als das „schwache“ anthropische Prinzip lässt sich das „starke“ allerdings nicht direkt auf die Biologie übertragen. Physik und Biologie sitzen naturwissenschaftlich nicht im gleichen Boot. Denn wir wissen nicht, ob die Entstehung von Leben bzw. die Existenz des Menschen evolutionär von fein abgestimmten Anfangs- und Randbedingungen abhängig war, und welche dies gegebenenfalls waren. Wie wahrscheinlich war der Übergang von unbelebter Materie zu belebter Materie? Die Antwort setzt ein theoretisches Verständnis des Vorgangs voraus, das bisher fehlt. Gar nichts wissen wir über die Wahrscheinlichkeit für die Entstehung von Intelligenz oder des Menschen in der Evolution.
Die verwirrende Vielfalt des Mesokosmos
Die Frage, in welcher Weise die Welt anders sein könnte als die vorfindliche, kann physikalisch formuliert werden, weil Mikro- und Makrokosmos strukturell einfach beschreibbar sind (wenn auch höchst unanschaulich durch eine anspruchsvolle Mathematik). Die Biologie hat es dagegen mit dem Mesokosmos zu tun, dessen Merkmal eine Unendlichkeit von möglichen Organisationsformen der Materie ist, eine uferlose Komplexität, die in belebten Systemen gipfelt. Zwar sind Modelle machbar, die auch komplexe und teilweise kontingente Phänomene wie Evolutionsprozesse auf einer definierten Verstehensebene in Raum und Zeit simulieren. Die biologische Evolutionstheorie bietet solche Modelle, die ihre Erklärungskraft immer wieder demonstrieren. Aber sie haben praktische und prinzipielle Grenzen durch die vereinfachenden Annahmen, die sie machen müssen, durch begrenzte Datenverfügbarkeit usw. Wir kennen bisher die grundlegenden, dynamischen Mechanismen nicht, die in der Evolution wirken, wenn wir sie auf einer sehr großen Zeit- und Raumskala betrachten.
Die Verstehensebene der evolutionsbiologischen Forschung ist kleinteiliger. Es geht um Mutation und Rekombination, um Selektion, ökologische Nischen und Artbildung, und um die Entstehung von Innovationen innerhalb vorgegebener Baupläne, zum Beispiel um die Entstehung des Schildkrötenpanzers bei Reptilien vor über 200 Millionen Jahren, oder um die Entstehung des Fledermausflugs bei baumbewohnenden Insektenfressern vor rund 60 Millionen Jahren. Solche Innovationsprozesse werden zunehmend verstanden. Aber sie sind einzelne Bausteine der Stammesgeschichte und sagen uns nicht unbedingt etwas über die Eigenschaften des gesamten Evolutionsgangs. Ist zum Beispiel die stetige Zunahme an Komplexität in der Evolution ein grundlegender Mechanismus? Wenn es so wäre ließe sich begründen, dass die Evolution zu einem intelligenten Gehirn führen muss, denn diese Struktur ist der Gipfel der stammesgeschichtlichen „Komplexifizierung“. Aber universell ist dieser Prozess eben nicht. In einigen Gruppen wurde zwar immer wieder ein „kritischer Zustand“ erreicht, aus dem eine neue Komplexitätsebene entstand, aber in anderen nicht. Was das Nervensystem angeht, gibt es solche Komplexitätssprünge vor allem bei Wirbeltieren und Weichtieren (Mollusken), was die soziale Organisation angeht, bei Insekten. Die meisten Gruppen verharren in der Evolution auf einen stabilen Level der Komplexität, viele wurden auch simpler (zum Beispiel Parasiten). Wo es Komplexitätsschübe gab, setzten sich diese aber ökologisch jeweils durch. Haben sie also doch eine gewisse Notwendigkeit? Der Freiburger Genetiker Carsten Bresch plädierte im Blick auf das tierische Nervensystem und das menschliche Gehirn für das Erstere. Der Paläontologe Stephen Jay Gould vertrat die gegenteilige Auffassung. Die Evolution, könnte man sie an irgend einem Punkt neu starten, würde nach seiner Ansicht zu gänzlich anderen Ergebnissen führen. Der Paläontologe Conway Morris argumentiert wiederum gegen Gould, und zwar mit der Allgegenwart von parallelen Evolutionsprozessen, von Konvergenzen.
Viele Wege, wenige Resultate?
Das Facettenauge der Insekten ist eines von Conway Morris Beispielen, denn es ist trotz seiner Komplexität bei mehreren Gruppen von Gliedertieren unabhängig entstanden. Im Bauplan der Gliedertiere stellt das Facettenauge also ein evolutionäres Produkt dar, das mit großer Wahrscheinlichkeit auf verschiedenen Wegen erreicht wird. Aber nicht immer, denn es gibt einige Spinnen mit Kameraaugen, und nahe Verwandte unter den Borstenwürmern haben sie ebenfalls entwickelt. Dennoch spricht die Allgegenwart solcher Konvergenzen in der Stammesgeschichte dafür, dass trotz der statistisch nahezu unendlichen Entwicklungsmöglichkeiten die Ergebnisse der Evolution inhärent in gewissem, vielleicht in hohem, Maß determiniert sind. Allerdings gilt dieser Schluss nur für die „mittlere“ Ebene der Evolution innerhalb bestehender Baupläne. Auf der Ebene der Gesamtökologie könnte es anders sein. Es ist sicherlich so, dass der „große“ Prozess der Evolution rückgekoppelt verläuft, dass seine eigenen Resultate die Bedingungen für weitere Veränderungen verändern. Es könnte deshalb in der Naturgeschichte Phasen mit hohem und mit geringem Innovationspotential gegeben haben. Seit 500 Millionen Jahren hat sich zum Beispiel kein neuer Tierstamm, also kein grundsätzlich neuer Bauplan im Tierreich, mehr etabliert.
Aber immerhin ließ sich – so meinte man – die damalige Entstehung der fünf basalen Tierstämme an ihren Bauplänen erkennen: Die Schwämme stehen an der Basis, da sie weder echte Gewebe, noch Nerven oder Muskelzellen aufweisen. Von ihnen leiten sich alle übrigen Tiere ab, die kuriosen Plattentierchen, die Rippenquallen und die Nesseltiere (Medusen und Polypen), die zusammen die Schwestergruppe aller spiegelsymmetrisch gebauter Tiere (Bilateralia) bilden. (Zu letzteren gehören die Wirbeltiere und der Mensch.) Kladistische Analysen störten jedoch diesen scheinbar offensichtlichen Weg vom Einfachen zum Komplexen. Sie rückten die Rippenquallen näher an die Bilateralia als an die Nesseltiere heran, aber immerhin standen die Schwämme weiter an der Basis des Tierreichs. Doch seit 2013 liegt von Schwämmen, Rippenquallen, Nesseltieren, Bilateralia und Plattentieren mindestens je eine vollständige genetische Sequenz vor. Ihr Vergleich spricht derzeit dafür, dass Rippenquallen die Schwestergruppe aller anderen Tiere bilden, also auch der Schwämme. Ihre komplizierten Merkmale, so scheint es, sind unabhängig von denen der anderen höheren Tiere entstanden. Dieses Ergebnis belegt wieder einmal, wie irreführend es sein kann, ästhetische Ordnungs und Strukturerwartungen auf die Natur zu übertragen. Die Annahme, dass Komplexifizierung ein Grundgesetz der Stammesgeschichte bildet, bestätigte sich für die Herausbildung unserer Tierwelt vor mehr als 500 Millionen Jahren jedenfalls nicht.
Ein anderes Beispiel: Man erwartete bis vor einem guten Jahrzehnt eine Symmetrie zwischen der Anzahl aktiver Gene und der Komplexität eines Organismus: Je komplizierter, desto mehr genetische Information. Das erwies sich für höhere Lebewesen als grundsätzlich falsch. Antonis Rokas sagt zum Fall der Rippenquallen: „Mit dem Befund... sollten wir die von teleologischem Denken geprägte Vorstellung ablegen, dass die frühe Evolution der Tiere wie ein linearer Vormarsch evolutionärer Formen von 'einfach' nach 'komplex' verlief.“ An die Stelle einer ästhetischen Gestalt der Stammesgeschichte tritt damit eine dramatische Gestalt. Sie nimmt stärker die Züge einer echten Geschichte an, verglichen mit ihren „mittleren“ Prozessen. Dazu gehört auch die Einsicht, dass der Gang der Evolution (anders als die Entwicklung des Kosmos) durch Zufallsereignisse entscheidend beeinflusst wurde. Das bekannteste Beispiel ist der Einschlag eines Meteoriten am Ende der Kreidezeit, der die Dinosaurier auslöschte und die Ausbreitung der Säugetiere ermöglichte. Ohne dieses ebenso monumentale wie unvorhersehbare Geschehen hätte es vielleicht intelligentes Leben auf Terra gegeben, aber sicherlich keine Menschen. Die Dynamik der Evolution scheint auf verschiedenen Ebenen verschieden zu sein. Auf der einen Ebene werden Zufallsereignisse „weggemittelt“, auf der anderen Ebene bestimmen sie, was danach geschieht. Der Fluss der Geschichte durchläuft Kurven und Stromschnellen, und auch das Leben kann – wie Heraklit es sagte – nicht zweimal im gleichen Fluss baden.
Das unendliche Universum und das Leben
Die Folgerung ist unausweichlich: Wir können tatsächlich nicht beurteilen, wie wahrscheinlich die Entstehung des Menschen, oder eines intelligenten Lebewesens, in der Evolution war. Falls allerdings die Entstehung des Lebens selbst nicht schon sehr unwahrscheinlich ist, falls es auf vielen Planeten im Weltall Leben geben kann, würde ein sehr großes Universum mit zahllosen Planetensystemen auch bei einer geringen Wahrscheinlichkeit des Einzelereignisses zwangsläufig irgendwo zu intelligentem Leben führen. Das heißt, die Unwahrscheinlichkeit von Intelligenz an sich (falls es so sein sollte) würde noch kein anthropisches Prinzip begründen. Die Bedingungen für die Entstehung von Leben, und für seine dynamische Evolution, müssten eine kosmologische Feinabstimmung erfordern. Zum Beispiel argumentieren Carter und McCrea damit, dass die irdische Evolution rund 4 Milliarden Jahre benötigt habe. Das passe größenordnungsmäßig zu der durchschnittlichen Aktivität eines sonnenähnlichen Sterns von 10 Milliarden Jahren. Simpel gesagt: Die Evolution des Menschen passt einmal oder zweimal in die Lebensdauer der Sonne, aber nicht öfters. Daraus versuchen sie zu schließen, die Entstehung intelligenten Lebens müsse einen oder zwei, aber nicht mehr, sehr unwahrscheinliche Schritte umfassen, und die Lebensdauer der Sonne sei darauf abgestimmt. Die Gegenwart des Menschen im Universum setze also, im Sinn eines „schwachen“ anthropischen Prinzips, diejenige Kosmologie voraus, die wir antreffen. Davies hält dem mit Recht entgegen, dass das Argument nur dann haltbar wäre wenn man wüsste, wie wahrscheinlich die Entstehung von Leben überhaupt ist, und wie inhärent determiniert oder kontingent die Dauer des Evolutionsprozesses ist. Das können wir nicht wissen, denn wir kennen nur ein einziges Beispiel. Daraus lässt sich nur schließen, dass die bisher unbekannten Voraussetzungen für die Entstehung des Lebens und des Menschen gegeben waren, denn die Erde ist belebt, und wir sind da. Diese Voraussetzungen zu untersuchen, ist ein Projekt zukünftiger Naturwissenschaft. Alles andere ist derzeit Spekulation.
Damit erübrigen sich – um mit einer theologischen Anmerkung zu schließen – auch die Versuche, aus der Evolutionstheorie Argumente für oder gegen den biblischen Schöpfungsglauben zu machen. Was auch immer die Forschung noch ergeben wird: die metaphysischen Deutungen werden sich im Ringelreihen jagen. Ergäben sich Gründe für die Annahme, dass die Entstehung des Menschen hochgradig kontingent war, würden die Einen von der Vorsehung des Schöpfers sprechen, und die Anderen vom blinden Spiel des Zufalls. Ergäben sich Gründe für das Gegenteil, nämlich für eine Determiniertheit der Hominisation, würde man sowohl einen Beweis für die Schöpfungsvernunft Gottes darin sehen, wie einen Beweis dafür, dass die Naturwissenschaft Gott überflüssig macht. Die Naturwissenschaft wird uns auch künftig unsere Existenz nicht sinnhaft deuten – und dennoch. Wir wüssten schon gerne, wie es kam, dass im gewaltigen Drama der Evolution Geschöpfe die Bühne betraten, die als Fische aus dem Urmeer stiegen, als ungeschlachte Vierbeiner die Wälder Gondwanas durchstreiften, als aufrecht gehende Jäger durch die Savannen Afrikas zogen, und schließlich in Mesopotamien Tempel bauten und unter dem Himmel der arabischen Wüste nach Gott fragten. Wie es dazu kam, wird die Naturwissenschaft uns vielleicht – aber nur vielleicht – einmal sagen können. Warum es so kam und was daraus werden soll, ist eine ganz andere Frage.
Hansjörg Hemminger (# Zur Person)
Veröffentlicht im Juli 2014
Sie lesen lieber aus einem Buch? Sie finden diesen Artikel auch in unserem Buch zu dieser Webseite, "Wissenschaft und die Frage nach Gott" (Bonn 3. Aufl. 2018). 18 Beiträge von renommierten Autorinnen und Autoren, darunter die Erzbischöfin von Schweden, führen in den Dialog mit der Wissenschaft angesichts der Gottesfrage ein.
Literatur
Carsten Bresch, Zwischenstufe Leben – Evolution ohne Ziel? München 1977
B. Carter, W. H. McCrea , The Anthropic Principle and its Implications for Biological Evolution, Phil. Trans. R. Soc. London, December 1983 Bd. 310 no. 1512, 347-363
Simon Conway Morris, Life’s solution, University Press Cambridge (UK) 2003
P. C. W. Davies, Searching for a Shadow Biosphere on Earth as a Test of the 'Cosmic Imperative', Phil. Trans. R. Soc. London, 2011 Bd. 369 no. 1936, 624-632
Stephen Jay Gould, The Structure of Evolutionary Theory, Cambridge (MA) 2002
Antonis Rokas, My Oldest Sister Is a Sea Walnut?, Science 342 1327-1329, 13 December 2013
Joseph F. Ryan et al, The Genome of the Ctenophore Mnemiopsis leidyi and Its Implications for Cell Type Evolution, Science 342 1242592-1 bis 1242592-8, 13 December 2013
Gunther M. Schütz, Der Aufbau von Komplexität in physikalischen Systemen, in: Jahrbuch der Karl-Heim-Gesellschaft 26, 2013
Bildnachweis
Reconstruction of Neandertaler at Neanderthal Museum @ Wikimedia Commons
Proganochelys, mit über 200 Millionen Jahren eine der ältesten Schildkröten der Welt, aus der Oberen Trias (Knollenmergel) von Trossingen. @ Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart
Sea walnut (Rippenqualle), Boston Aquarium @ Wikimedia Commons
starfield whirl © Tjefferson - fotolial.com
Musste der Mensch sein?
Ihre eigenen Gedanken zum anthropischen Prinzip in der Evolution
Hansjörg Hemminger schließt seinen Leitartikel so: "Wir wüssten schon gerne, wie es kam, dass im gewaltigen Drama der Evolution Geschöpfe die Bühne betraten, die als Fische aus dem Urmeer stiegen, als ungeschlachte Vierbeiner die Wälder Gondwanas durchstreiften, als aufrecht gehende Jäger durch die Savannen Afrikas zogen, und schließlich in Mesopotamien Tempel bauten und unter dem Himmel der arabischen Wüste nach Gott fragten. Wie es dazu kam, wird die Naturwissenschaft uns vielleicht – aber nur vielleicht – einmal sagen können. Warum es so kam und was daraus werden soll, ist eine ganz andere Frage." Was wäre Ihre Antwort auf diese Frage? Und was halten Sie vom anthropischen Prinzip in der Evolution?







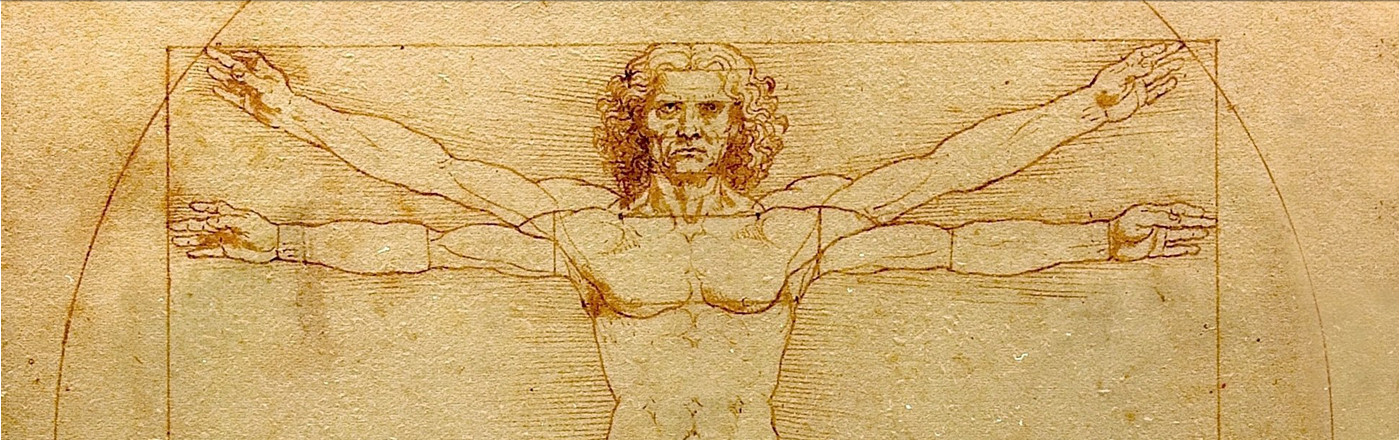








Kommentare (2)-

Antworten
Evolution oder Schöpfung? Wenn Sie an die Evolution glauben, dann haben Sie als Stammvater einen Affen. Dann sind Sie auch der Nachkomme eines Affen. Wenn Sie an die Schöpfung glauben, dann haben Sie als Stammvater GOTT. Dann sind sie ein göttliches Wesen. Ich habe mich gegen den Affen entschieden. http://ichthys-consulting.de/blog/?p=558
-

Antworten
Warum ziehen Gläubige die Wissenschaft häuftig auf ihr Niveau herunter? Man glaubt nicht an wissenschafte Erkenntnisse.
Uwe Melzer
am 16.07.2015Felix
am 04.05.2020Es ist doch keine Entscheidungssache: Ich will nicht vom Effen abstommen, darum ist es nicht so.
Aus Variation, Mutation und Vererbung folgt logisch Evolution.